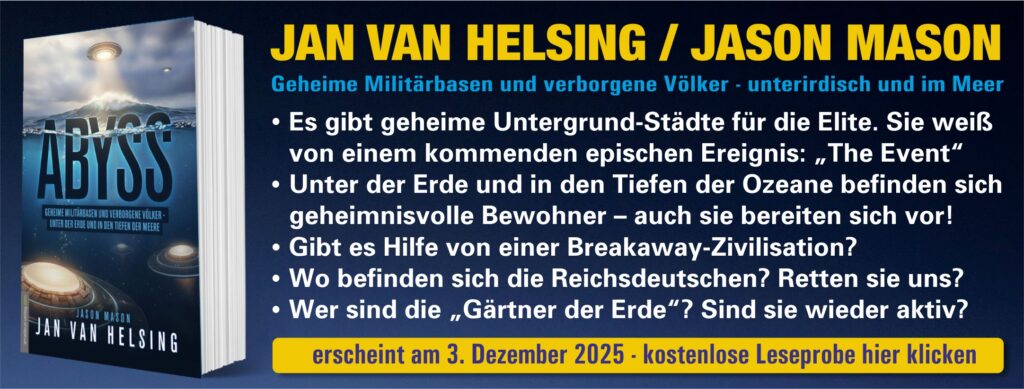Die Frage nach dem Grund, warum wir durch die frühzeitige Fremdbetreuung eine liebevolle Bindung an unsere Kinder aufs Spiel setzen, hat mich seit langem beschäftigt. Müssten unsere Babys und Kleinkinder nicht den tief verwurzelten, natürlichen Impuls in uns aktivieren, sie nahe bei uns haben zu wollen und ihnen Schutz und bedingungslose Liebe zu geben? Das Bedürfnis der Mutter nach Nähe zu ihrem Kind ist, wie beschrieben, eine Konstante des menschlichen Verhaltens.
Und doch wird die Trennung von Mutter und Kind als eine selbstverständliche Handlungsmöglichkeit gesehen. Vielfach wird es als Sentimentalität abgetan, wenn eine Mutter Bedenken äußert, schon Kleinstkinder einer Gruppe anzuvertrauen, in der sie nicht die Intensität von Nähe erfahren, die in der Mutter-Kind-Beziehung möglich ist.

Das aufstrebende Bürgertum übernahm diese neue Gewohnheit. Der energische Erziehungsstil war Ausdruck und damit auch Symbol politischer, kultureller und wirtschaftlicher Veränderung. Kinder hatten sich vom ersten Tag an in die erwachsene Welt der Pflichten einzuordnen, sie hatten so »pflegeleicht« wie möglich zu sein.
Nach und nach gaben auch Arbeiterinnen ihre Kinder weg, oft zur Nachbarin, wo sie vielfach mit Mehlbrei und Wasser, »zu Tode« ernährt wurden. Die Findelhäuser quollen über, es fehlte nicht nur die Mutterbrust, sondern auch die liebevolle Zuwendung. Die industrielle, Revolution benötigte immer mehr Arbeitskräfte, für das Stillen blieb keine Zeit. 1866 gab es das erste Nestlé-Babynahrungsprodukt, und damit schienen alle Probleme endgültig gelöst.
Schon lange vorher war es unüblich geworden, dass Eltern und Kleinstkinder gemeinsam in einem Bett schliefen. Bereits im Mittelalter setzte sich die körperliche Distanz der Eltern zum Säugling durch. Damals predigte die Kirche, dass die Kinder wegen der hohen Sterberate durch Erstickung und Erdrücken nicht im Elternbett schlafen sollten. Das war zwar eine Behauptung, die nicht zutraf, sondern Ausdruck kirchlicher Körperfeindlichkeit, Inzestbefürchtungen eingeschlossen. Doch sie konnte sich bis zum heutigen Tag beharrlich halten.
Das sogenannte Co-Sleeping, also das gemeinsame Schlafen von Eltern und Kind, ist alles andere als gefährlich für das Baby, das Gegenteil ist der Fall. Durch Studienversuche mit Nacht- und Wärmekameras wurde belegt: Mütter merken im Schlaf instinktiv, wenn mit ihren Kindern etwas nicht stimmt, wenn es zum Beispiel zu warm wird oder die Gefahr eines plötzlichen Kindstodes entsteht. Ohne es selbst zu bemerken, stupsen Mütter in solchen Situationen unbewusst die Kleinen an, was die Luftzirkulation sofort verändert.
Die einzige Ausnahme, in der zum gemeinsamen Nachtschlaf abgeraten wird, ist dann gegeben, wenn Eltern Nikotin, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben. In allen anderen Fällen gilt, dass das gemeinsame Schlafen einen besonders effektiven Schutz für das Baby bedeutet. Nicht zufällig ist in Kulturen, in denen Kind und Eltern heute noch zusammen in einem Bett schlafen, die Rate des plötzlichen Kindstodes viel niedriger als bei uns.
Dennoch wird im Rhythmus von zwei, drei Jahren regelmäßig die Behauptung aufgestellt, es sei gefährlich, wenn kleine Kinder im Bett der Eltern schliefen. Nach einigen Recherchen entdeckte ich einen der Urheber einer solchen Warnung. Es handelte sich um einen aufstrebenden Möbelhersteller, der anscheinend seinen Erfolg im Verkauf von Kinderbetten sah. Man könnte schmunzeln darüber, wären die Folgen nicht so fatal.
Wenn wir die Geschichte des familiären Zusammenlebens betrachten, fällt also auf, dass die räumliche und damit auch emotionale Distanz zwischen Eltern und Kindern immer stärker wurde. Selbst Mediziner fielen in den Tenor ein, als Louis Pasteur auf die Ansteckungsgefahr durch Mikroben hinwies. Ein eigenes Kinderzimmer wurde fortan als wichtige Voraussetzung für die Gesundheit des Säuglings angesehen.
So gibt es bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreiche Einzelentwicklungen, die Kinder immer weiter von ihren Eltern entfernten.
Was viele nicht wissen: Unsere distanzierte Haltung zu unseren Kindern steht auch in einem direkten Zusammenhang mit einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, dem Dritten Reich. Die Theoretiker des Nationalsozialismus erkannten früh, dass die Frage der Kindererziehung höchste politische Relevanz hatte. Das beschränkte sich nicht auf die erwünschte Steigerung der Geburtenrate, die sich in der Auszeichnung mit dem »Mutterkreuz-Orden« für Frauen mit vielen Kindern ausdrückte. Es betraf vielmehr die konsequente Einflussnahme auf den vormals privaten, familiären Bereich von Geburt, Mutterschaft und Säuglingspflege. Es ging nicht nur darum, »dem Führer Kinder zu schenken«, sondern die Kinder so früh wie möglich nach den Maßgaben des nationalsozialistischen Menschenbilds zu formen.

Das begann damit, dass im Nazi-Staat die bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts erprobten und routinemäßig eingesetzten schmerzstillenden Medikamente während der Geburt nicht mehr verwendet werden durften. Der Geburtsschmerz sei eine Tapferkeitsprobe, so die neue Lehrmeinung. Die Gebärende wurde zur Soldatin auf dem Schlachtfeld stilisiert, und so kommentierte denn auch der nationalsozialistische Gynäkologe Walter Stoeckel die acht Schwangerschaften seiner Frau: »Sieben Geburten und eine Fehlgeburt sind sieben Gesundheitsschlachten und eine Manöveranstrengung.«
Die Forderung, Frauen müssten den Geburtsschmerz aushalten, hatte aber auch noch einen anderen Hintergrund: Auf diese Weise wurde die Mutter-Kind-Beziehung von vornherein negativ geprägt. Heute weiß man, dass eine massive Ablehnung des Neugeborenen durch den erlittenen Schmerz während einer Geburt möglich ist, bis hin zu Vernachlässigung und Misshandlung. Das wurde bewusst in Kauf genommen, um »übertriebene Muttergefühle« von Beginn an zu unterbinden. Um das zu unterstützen, wurde eine vierundzwanzigstündige Trennung von Mutter und Kind nach der Geburt propagiert, der natürliche Impuls nach Nähe zwangsweise unterdrückt.
Die dramatischen Folgen dieser Trennung sind heute hinreichend erforscht, doch auch schon in den zwanziger Jahren hatten Mediziner Erkenntnisse darüber gewonnen, die nun bewusst in Kauf genommen, sogar begrüßt wurden. Eine emotionale Bindung der Mutter an ihr Kind, das sogenannte Bonding, wird besonders mit der Erfahrung körperlicher Nähe zwischen Mutter und Neugeborenem nach der Geburt gefördert. Frauen, die von ihren Neugeborenen getrennt werden, kann es längere Zeit schwerfallen, einfühlsam auf ihr Kind zu reagieren und eine innige Beziehung zu ihm zu entwickeln.
Den Nationalsozialisten war das nur recht. Stand schon das Geburtsgeschehen unter der Leitidee, allzu große Gefühle gar nicht erst entstehen zu lassen, setzte man dieses Denken mit den Vorgaben zur Säuglingspflege fort. In “Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind” legte Johanna Haarer, überzeugte Nationalsozialistin und Autorin von mehreren Erziehungsbüchern, eine umfassende Anleitung vor, wie Mütter mit ihren Kindern umgehen sollten. Das schaurige Werk der Münchner Ärztin mit ihren entsetzlichen Empfehlungen erschien erstmals 1934 und wurde bis zum Ende des Krieges mehr als eine halbe Million Mal verkauft. 1936 kam “Unsere kleinen Kinder” auf den Markt, ebenfalls ein Bestseller. Es wurde das Grundlagenwerk der »Reichsmütterschulung« und galt als wegweisend.
Zwei Gedanken prägten Johanna Haarers Bücher: die physische Trennung von Mutter und Kind und die emotionale Distanz.
Eindringlich warnte sie vor einem »Übermaß an Liebe« und empfahl, den Säugling einzig zum Stillen in den Arm zu nehmen. Mit anderen Worten: Wenn das Baby schreit, lautete die Devise: »Schreien lassen«; »Liebe Mutter, werde hart«, gab Haarer zu verstehen. »Fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bette herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf dem Schoß zu halten.« Das Stillen war allein zu festgelegten Zeiten erlaubt und sollte so rasch und nüchtern wie möglich erfolgen, da es ohnehin jeder Frau »auf die Nerven gehe«. Denn »sonst geht ein endloser Kuhhandel mit den kleinen Plagegeistern los«.
Plagegeister? Die Schriften der Johanna Haarer degradieren Kinder systematisch zu widerspenstigen Störenfrieden, die man besser nicht zu nah an sich heranlässt. »Kleine Nichtsnutze« nennt sie den Nachwuchs, Erziehung ist für sie der Kampf gegen den Willen des Kindes, alle elementaren menschlichen Gefühle werden als »Affenliebe« eingestuft. Zärtlichkeiten waren verpönt, Küsse wurden mit dem Hinweis auf »Tuberkelbazillen« als Gesundheitsrisiko eingestuft. Generell empfiehlt sie »das Unterlassen jeder unnötigen Beschäftigung« mit dem Kind. »Pflege und Wartung« seien diszipliniert durchzuführen – eine Wortwahl, die eher an Autos erinnert als an den Umgang mit Kindern.
Alle kindlichen Bedürfnisse nach Geborgenheit und Nähe werden als Tyrannei bewertet, im Zentrum der Mutter-Kind-Beziehung stand für Haarer das Postulat, das Kind zur »Selbständigkeit« zu erziehen. Was damit wahrhaft gemeint war, ist klar: Es ging darum, bindungslose Kinder heranzuziehen, die sich früh in das nationalsozialistische Erziehungssystem integrieren ließen. Soldatische Tugenden wie Disziplin und Gehorsam wurden den Kindern vom ersten Schrei an abgefordert, das Bereitstellen von Nachwuchs, der sich mühelos in das System eingliedern ließ, war oberstes Gebot. Der NS-Pädagoge K.F. Sturm schwärmte denn auch von jungen Menschen, die die Erfahrung des »deutschgemeinschaftlichen Lebens« machten, und Reichsminister Wilhelm Frick forderte die »gliedhafte Einordnung« ins »Volksganze«. »Der Privatmensch existiert nicht mehr, er ist begraben.«
AU — das klingt heute erschreckend, die politischen Folgen sind bekannt. Und so ist es kaum zu verstehen, dass Johanna Haarers Werke nach dem Krieg nicht etwa in Vergessenheit gerieten, sondern seit den fünfziger Jahren zahlreiche Neuauflagen erlebten. Rund 1,2 Millionen dieser Bücher sind über den Ladentisch gegangen.

Die Geringschätzung der Bindung, die Ablehnung der »kleinen Plagegeister« und »Nichtsnutze« mit ihrem Wunsch nach mütterlicher Nähe und Aufmerksamkeit hat also eine unheilvolle Tradition in Deutschland, die sich im System der DDR fast nahtlos fortsetzte. Kinder wurden letztlich als »Sand im Getriebe« gesehen, als Störfaktor im wirtschaftlichen Geschehen, und die frühe Fremdbetreuung hatte überdies den Vorteil, sie von vornherein der privaten Obhut zu entziehen und sie auf die staatliche Ideologie einzustimmen.
Auch wenn heute vordergründig keine Gedanken dieser Art mit der Forderung nach frühester Fremdbetreuung von Kindern verbunden sind, so muss man die Vorrangstellung der Berufstätigkeit vor den emotionalen Bedürfnissen dennoch als ideologische Einflussnahme bezeichnen: Die ökonomischen Anforderungen stehen heute im Verdacht, den Rang einer Weltanschauung und Lebenseinstellung eingenommen zu haben. Wir sollen »opferbereit« sein wie die Mütter im Nationalsozialismus, wir sollen unsere Gefühle unterdrücken, uns von ihnen befreien, um ohne Sehnsüchte und ohne schlechtes Gewissen unserer Erwerbstätigkeit nachzugehen.
Bei der Frage von Babykrippen und Betreuungseinrichtungen gilt daher nicht ohne Grund das Motto: »Je früher, desto besser. Wer sich bindet, ist schwach; wer sich möglichst nüchtern verhält und Bindungen vermeidet, ist am ehesten in der Lage, sein Kind fröhlich lächelnd in fremde Hände zu geben.« In Einrichtungen, wo es versorgt, aber, ganz bestimmt nicht auf den Arm genommen und mit Zärtlichkeiten bedacht wird. Johanna Haarer wäre zufrieden.
Auszug aus dem Bestseller Das Eva-Prinzip von Eva Herman, erschienen 2006
Sie bekommen alle neuesten Artikel per E-Mail zugesendet.