Wenn man lange genug immer wieder weiter links abbiegt, kommt man irgendwann vollkommen vom Weg und Ziel ab. So scheint es den ganzen woken Genderleuten und Antirassisten zu gehen, die überall „Rechtsextreme“ und „Rassisten“ wittern und damit eigentlich genau das erreichen, was sie doch eigentlich bekämpfen wollten. Ein Bericht aus Deutschland, dem Land des gutmeinenden Wahnsinns, lässt grübeln, was eigentlich „Rassismus“ ist.
Eine kleine Geschichte aus eigener Erfahrung: Wir haben hier in unserem winzigen Dorf einen Buben, der aus der ersten Ehe seiner Mutter mit einem Schwarzamerikaner stammt. Was man auch sieht. Der Junge wuchs hier ganz frei auf und wurde nirgends schief angesehen oder dumm angeredet, empfand sich nie als Außenseiter. Er guckte alle Filme mit seinen Kumpels, er bolzte Fußball mit den anderen auf der Wiese und war, wie alle Jungs im Teenageralter, auch eine Weile sehr schwierig, in der Schule stinkfaul und machte das, was alle seine Altersgenossen tun: Probleme aus Übermut, den Mädels nachpfeifen, ohne Führerschein Moped fahren und den Eltern und Lehrern sattsam auf die Nerven gehen. Seine Eltern machten das, was alle Eltern machen: Sich sorgen.
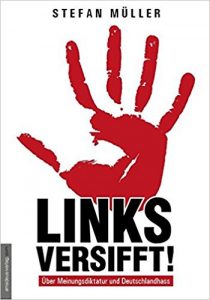
Da ich das von meinem Sohn in dem Alter kannte, hab ich den Eltern gesagt, sie sollen nicht dauernd an ihm herummeckern und mit ihren Erwartungen und Sorgen den Jungen in die Defensive drängen. Sie sollen ihn für gute Dinge, die er tut, loben. Sie sollen ihm sagen, dass sie stolz auf seine Hilfsbereitschaft und Gutherzigkeit sind. Das löst sich bald alles in Wohlgefallen auf, weil der Bub aus gutem Holz geschnitzt ist. Und ihm hab ich gesagt, dass ich weiß, dass aus ihm ein guter Mann werden wird. Er soll’s nur nicht übertreiben mit seinen wilden Jahren.
Nun, er ist ein guter Mann geworden, ein hübscher Kerl, macht seine Lehre als KFZ-Mechaniker fertig (das heißt heute KFZ-Mechatroniker), und er wird sicher bald eine nette Frau finden. Alles ist bestens, zurzeit trägt er abends als Nebenerwerb noch Pizza aus für Luigis Pizzeria. Dass seine Haut dunkel ist, interessiert hier kein Schwein. Es ist einfach kein Thema. Niemand macht irgendein Gewese draus.
Käme nun so ein Gutmenschbeflissener, der ihm ständig mit irgendeinem Rassismusthema in den Ohren läge, was er alles übel nehmen muss, wann und wo er mal wieder diskriminiert wird, würde ihm das nur auf den Keks gehen. Ja, es gibt Rassismus, den hat er auch schon erlebt. Da er aber einer von uns hier im Dorf ist, ficht ihn das nicht an.
Gegen echten Rassismus kann man auch klug und einfühlsam angehen, aber konstruktiv und integrativ anstatt die Außenseiter- und Opferrolle noch verstärken, wie das in Bremen gemacht wird: Da hat eine „schwarze Kinderbibliothek“ aufgemacht. Nein, das sind keine Gothic-Fans die nur schwarz eingebundende Bücher in mattschwarz gestrichenen Räumen auf schwarzen Teppichböden anbieten. Es ist eine Bibliothek, die ausschließlich Bücher verleiht, in denen schwarze Kinder die Helden sind. Natürlich kann man das auch haben, warum auch nicht?
Eines meiner absoluten Lieblingsbücher war als Kind das Buch von James Vance Marshall, „The Children“. Es kam 1959 heraus und handelt von dem Geschwisterpaar Mary und Peter, das im australischen Outback, fern jeder Zivilisation, nach einem Flugzeugabsturz allein in der Wildnis steht. Verloren und orientierungslos wären die beiden verdurstet und verhungert, wenn ihnen nicht zufällig ein Aboriginee-Junge begegnet wäre. Der schwarze Junge begreift schnell, dass er seine rituelle Reise, das sogenannte „Walkaround“ auf den Traumpfaden unterbrechen muss, um sich um die beiden hilflosen weißen Kinder zu kümmern. Die Kinder betrachten den nackten, dunkelhäutigen Buben mit Befremden. Nackt herumzulaufen ist für sie undenkbar.
Der „Bushboy“ führt sie zu einer Wasserstelle und zeigt ihnen, wie sie Nahrung finden und Feuer machen. Die weißen Kinder verstehen, dass sie auf den schwarzen Jungen angewiesen sind und sie verstehen auch schnell, dass er weiß, wie man in dieser lebensfeindlichen Umwelt leben kann, dass er viele Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt, die ihnen fehlen – und ohne die sie nicht überleben werden. Sie finden Wege zur Verständigung und lernen sehr schnell sehr viel von dem Jungen.
Leider stecken die weißen Kinder den „Busch-Jungen“ mit einer Erkältung an: Eine für sie harmlose Erkrankung, die sie gar nicht bemerken, an der der Busch-Junge aber verstirbt, weil seine Leute diese Erreger nicht kennen. Er weiß das in voller Klarheit, er spürt seinen Tod kommen. Vorher zeigt er den beiden weißen Kindern aber, wie sie mit seinem Leichnam verfahren müssen, damit die Tiere ihn nicht fressen und er gemäß der Tradition auf die andere Seite wechseln kann. Die beiden weißen Kinder sind bekümmert und traurig. Sie folgen genau seinen Anweisungen als eine letzte Geste ihrer großen Dankbarkeit. Anschließend machen sie sich aufgrund seiner guten Beschreibung auf den Weg in das Tal, wo sie tatsächlich Wasser und Nahrung im Überfluss finden. Als nach einer ganzen Zeit Aboriginees in das Tal kommen und die Kinder entdecken, leben beide dort mittlerweile ganz nackt und so, wie der indigene Junge sie das gelehrt hatte. Sie kennen die essbaren Pflanzen, fangen Fische und erlegen kleinere Tiere.
Dank der Aboriginee-Gruppe kommen sie auch zurück in die Welt der weißen „Zivilisation“ der europäischen Einwanderer in Australien. Am Ende schimmert indirekt durch, dass die Geschwister die weiße Zivilisation jetzt mit anderen Augen sehen als vorher. Sie haben gefühlt und verstanden, dass das, was wir „Zivilisation“ nennen, nur eine dünne, schöne Lackschicht ist, auf die wir zwar stolz sind, die aber sehr schnell abblättert, wenn die fragilen Strukturen der Zivilisation nicht mehr greifen. Sie haben auch kennengelernt, wie die Aboriginees denken und fühlen und wie tief ihre Seelen mit ihrem Land verbunden sind. Ein sehr beeindruckendes Buch, das ohne große Worte und erhobenen Zeigefinger eine völlig neue Sicht auf die Menschen als Naturwesen, als Zivilisations-Wesen und die Identität der Völker eröffnet.
Der Held der Geschichte ist der schwarze, „wilde Bushboy“, der in Abwägung seiner moralischen Pflichten — die bedürftigen weißen Kindern zu retten oder seine Mission, den Walkaround auf den Traumpfaden ohne Kontakt zu anderen Menschen zu vollenden – sich für den Abbruch des Walkaround und die Rettung der Kinder entscheidet, auch wenn es sein Leben kostet. Das wäre ein gutes Buch für Kinder aller Hautfarben.
 Diese unbewusste Überheblichkeit, die viele Gutmenschen hier glauben lässt, sie müssten die Nicht-Weißen ans Händchen nehmen und ihnen helfen, mit dem Leben zurechtzukommen, ist eine andere Spielart von (gut gemeintem) Rassismus. Got news for you, folks: Diese Leute sind meistens überlebensfähiger als ihr. Manche davon riechen zehn Meter gegen den Wind, wen sie wie benutzen können und aus wessen Helfersyndrom sie welche Vorteile gewinnen können. Das ist nicht unbedingt böse gemeint. Es ist eine Überlebenstechnik. Und wer sich als gönnerhafter, engagierter Gutmensch geriert, wird auch für alles herangezogen und in die Pflicht genommen.
Diese unbewusste Überheblichkeit, die viele Gutmenschen hier glauben lässt, sie müssten die Nicht-Weißen ans Händchen nehmen und ihnen helfen, mit dem Leben zurechtzukommen, ist eine andere Spielart von (gut gemeintem) Rassismus. Got news for you, folks: Diese Leute sind meistens überlebensfähiger als ihr. Manche davon riechen zehn Meter gegen den Wind, wen sie wie benutzen können und aus wessen Helfersyndrom sie welche Vorteile gewinnen können. Das ist nicht unbedingt böse gemeint. Es ist eine Überlebenstechnik. Und wer sich als gönnerhafter, engagierter Gutmensch geriert, wird auch für alles herangezogen und in die Pflicht genommen.
Der Helfer zieht ja auch immer eine Trennlinie zwischen “Du hilfloses, unterlegenes Opfer dort“ und „ich edler, überlegener Retter hier“, auch wenn er das vehement abstreiten würde. Es gibt genug Flüchtlingsbetreuer, die irgendwann nicht mehr können. Oder die bemerken, dass sie das Gegenstück ihres Helfersyndroms getroffen haben, nämlich den betreuungsbedürftigen Vampir, der den Helfer bis zum Burnout beansprucht.
Die erwähnte schwarze Kinderbibliothek in Bremen sei entstanden, weil sich die schwarzen und afro-deutschen Kinder in den Schulbüchern nicht ausreichend repräsentiert fühlen, meinen die Initiatoren der „schwarzen Kinderbibliothek“. Und die Initiatoren erläutern: „Rassismus beginnt nicht, wenn ein Mensch angegriffen wird, sondern bereits in Bildung und allen weiteren gesellschaftlichen Bereichen“.
Und natürlich geht es um Selbstermächtigung, Inspiration und „Empowerment“. Es gibt Workshops für Familien in schwarzer Kinderliteratur. Mit anderen Worten: Hier wird den Kindern erst recht eingebläut und begreiflich gemacht: Du gehörst hier nicht hin. Deine Hautfarbe ist der Grund dafür. Nur hier, unter Deinesgleichen, da geht es Dir gut, da bist Du aufgehoben und sicher.
In der „schwarzen Kinderbibliothek“ gibt es aber auch Bücher über Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus und über die Schönheit der Diversität. Spätestens damit ist klar, woher der Wind weht. Was sollen Kinder mit Antisemitismus anfangen? Sie wissen doch gar nicht, um welche Leute es sich da handelt. Warum muss man ihnen überhaupt den Gedanken ins Hirn injizieren, dass jüdische Menschen irgendwie so etwas ganz anderes sind und es Leute gibt, die sie überhaupt nicht mögen? Alles, was im Kinderköpfchen steckenbleibt ist, dass Juden irgendwie ganz komische Leute sind und dass man sehr aufpassen muss mit ihnen (!?!) … und die Kinder werden nicht mehr unbefangen sein. Tolle Leistung.
Selma Green, die sich selbst als Farbige bezeichnet, hat eine sehr persönliche, herzerfrischende Stellungnahme zu der schwarzen Kinderbibliothek geschrieben. Unverkrampft, selbstbewusst, reflektiert und frei. Ich könnte sie knuddeln:
„Laut Sheeko Ismail, einer der Initiatoren der Bibliothek, soll außerdem Wissen darüber vermittelt werden, wie vielfältig Schwarzes Leben in Deutschland ist. Und trotz des „vielfältigen Schwarzen Lebens” stehen in der Bibliothek gerade mal etwas weniger als 100 Bücher, von denen viele auf Englisch sind. Neben der Tatsache, dass die wenigsten Kindergarten- und Grundschulkinder Englisch verstehen, stellt sich mir da wirklich die Frage: Welches Kind sollte sich für so eine Bibliothek interessieren? Ich selbst bin durch meine nigerianischen Wurzeln gut gebräunt. Und als Kleinkind war mir meine Hautfarbe völlig schnurz. Mein Aussehen hat mir nie irgendwelche Schwierigkeiten bereitet, eben weil die Hautfarbe bei Kindern schlicht keine Rolle spielt. (…) Ich war eher stolz darauf, dass ich anders aussehe – wenn ich es nicht grade vergessen habe. Für mich war es das normalste der Welt, dass alle um mich herum weiß sind und es war deshalb auch normal, Bücher mit weißen Figuren zu lesen.“
Selma Green legt auch zielgenau den Finger in die Wunde:
„Die Idee eine Bibliothek zu eröffnen, die extra für Schwarze ist, ist nicht nur völlig absurd, sie ist rassistisch – ein Hirngespinst der Linken. Ich meine: Wer ist es denn, der die Hautfarbe in jeder Situation zum Thema macht? Schwarze werden von Linken nur wegen ihrer Hautfarbe behandelt, als wären sie unfähig. Jeder der nicht weiß ist, ist nach den selbsternannten Moralaposteln automatisch ein Opfer von Rassismus und müsse deshalb besonders behandelt werden. Jemanden wegen seiner Hautfarbe anders zu behandeln, ist doch aber die Definition von Rassismus. Warum in aller Welt sollte ich wegen meiner Hautfarbe kein Selbstvertrauen haben? Warum sollte ich wegen meiner Hautfarbe eine eigene Bibliothek brauchen? Ich bin vielleicht farbig, aber deswegen noch lange kein Opfer. (…) Man redet schwarzen Kindern ein, sie bräuchten unbedingt Bücher, die auf ihre Hautfarbe zutreffen. Wenn man mir damals erzählt hätte, ich sollte wegen meiner Hautfarbe andere Bücher lesen, wäre ich todtraurig gewesen – ich hätte mich ausgegrenzt gefühlt. Also: Wo bleibt die sonst an jeder Stelle propagierte Vielfalt und Antidiskriminierung?“
Liebe Selma Green: Treffer. Versenkt.
Danke.

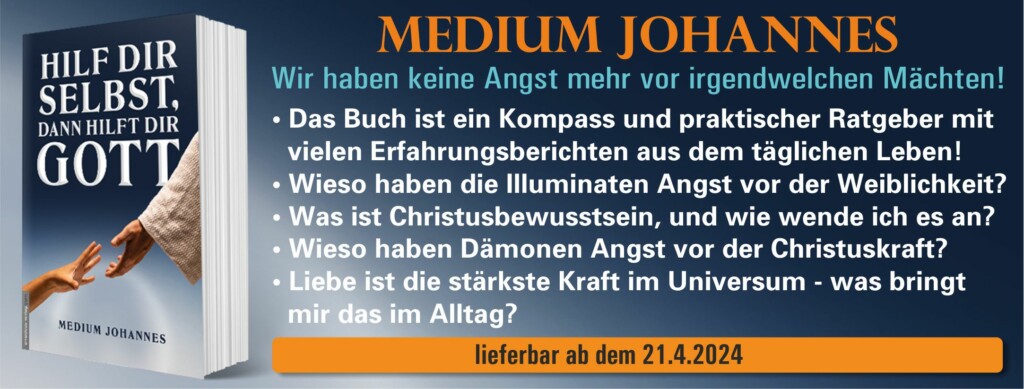




























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.