Der Titel Das Ende der Universität wirkt zunächst wie ein kulturpessimistisches Lamento, doch der von Harald Schulze-Eisentraut und Alexander Ulfig herausgegebene Sammelband erweist sich als tiefgründige und differenzierte Analyse des Zustands der europäischen Universität im 21. Jahrhundert. In einer Vielzahl hochkarätiger Beiträge aus Philosophie, Politikwissenschaft, Soziologie, Pädagogik und Wissenschaftsgeschichte wird ein düsteres, aber notwendiges Bild vom Niedergang einer Institution gezeichnet, die über Jahrhunderte hinweg Trägerin von Wahrheitssuche, Bildungsideal und wissenschaftlicher Freiheit war.
Bereits das programmatische Vorwort (S. 1–7) skizziert mit klarer Feder, wie sich eine jahrtausendealte Institution – von den Scholarenuniversitäten des Mittelalters über die Humboldt’sche Bildungsreform bis hin zur heutigen »unternehmerischen Hochschule« – schleichend in ihr Gegenteil verkehrt hat. Die Ursachen sind vielfältig: Politisierung, Bürokratisierung, Digitalisierung, Bologna-Prozess, Gleichstellungspolitik, Cancel Culture – die Autoren lassen kein Tabu unangetastet.
Besonders hervorzuheben ist der Beitrag von Peter J. Brenner (Idee und Wirklichkeit der deutschen Universität, S. 8–27), der in klassischer Bildungssprache eine historische Genealogie der Universität liefert und zeigt, wie das humboldtsche Ideal der »Einheit von Forschung und Lehre« in eine bürokratisierte Illusion pervertiert wurde. Mit einer Fülle von historischen Belegen und einem scharfen Gespür für institutionelle Mechanismen schildert Brenner, wie aus der »Universitas magistrorum et scholarium« ein Marketingbetrieb mit Diversity-Abteilung wurde – entkernt und fremdbestimmt.
Noch radikaler diagnostiziert Egon Flaig in seinem Essay Die Intellektuellen ohne Universität (S. 28–40) den Bruch zwischen akademischer und geistiger Kultur. Für ihn hat sich der Typus des freien Intellektuellen längst aus der Universität zurückgezogen – nicht aus Mangel an Interesse, sondern aus Notwehr gegen eine Atmosphäre der Einschüchterung, Ideologisierung und Selbstzensur. Die Universität, so Flaigs These, ist nicht mehr Ort des Denkens, sondern der Konformität.

David Engels schließlich wagt in Ausweg aus der Bildungsmisere: ein neues Cluny? (S. 168–179) einen faszinierenden Vorschlag: Die Neugründung klosterähnlicher Bildungsstätten, in denen die Tugenden von Disziplin, Geistigkeit und Traditionsbindung in einer kleinen, aber intellektuell dichten Umgebung gepflegt werden – als letzte Bastion gegen das Auseinanderfallen des akademischen Ethos.
Trotz der Vielzahl an Stimmen ist der Band stilistisch kohärent, intellektuell anspruchsvoll und thematisch fokussiert. Der Reiz liegt gerade in der polyphonen Anklage: Es sind keine kulturpessimistischen Einzelmeinungen, sondern sich gegenseitig verstärkende Beobachtungen, die aus unterschiedlichen Fachbereichen das gleiche Bild zeichnen – das der Universitätslandschaft als Geisterstadt des Denkens.
So brillant die Analyse in Breite und Tiefe ist, so sehr fehlt dem Band ein systematischer Blick auf internationale Reformansätze, die als positive Kontrastfolie dienen könnten. Die Autoren konzentrieren sich fast ausschließlich auf Deutschland und Mitteleuropa. Gerade angesichts der globalen Dimension der Bologna-Reform und der Digitalisierung wäre ein komparativer Blick in Richtung angelsächsischer Modelle (z. B. Great Books Colleges in den USA oder kleine klassische Hochschulen wie Campion College in Australien) hilfreich gewesen. Hier hätte man zeigen können, dass Erneuerung nicht nur als konservatorischer Reflex zu denken ist, sondern als bewusst gestalteter Neuanfang aus der Krise heraus.
Das Ende der Universität ist ein Meilenstein des konservativen Bildungsdenkens im besten Sinne: Kein larmoyanter Abgesang, sondern ein leidenschaftlicher Appell zur Wiedergewinnung von Wissenschaftlichkeit, Urteilskraft und Freiheit. Der Band liest sich wie ein Weckruf – an Lehrende, Studierende, Politiker und Bürger. Wer wissen will, warum die Universität ihre Seele verloren hat und was noch zu retten wäre, kommt an diesem Buch nicht vorbei.
dwv-net.de/produkt/das-ende-der-universitaet/
ISBN: 978–3‑86888–211‑7
Der Artikel erschien zuerst bei freiewelt.net.

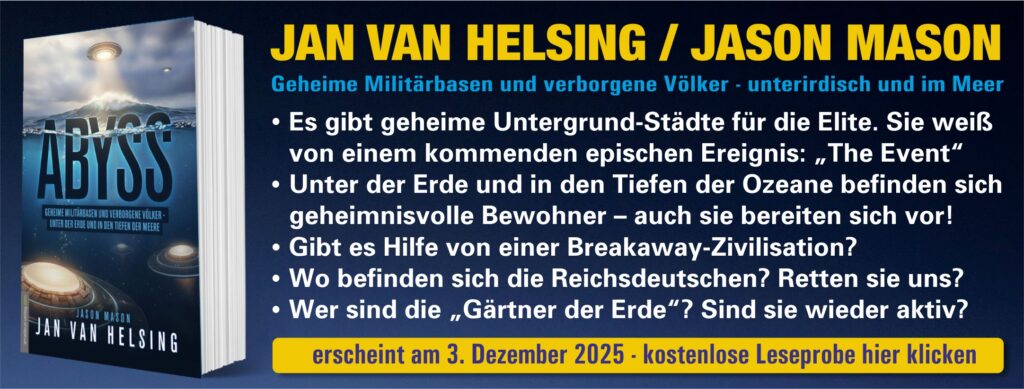
























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.