Maschinelle Lernalgorithmen, die auf Wellenformdaten von 2008 bis 2022 angewendet wurden, haben 86.276 Erdbeben unter der Yellowstone-Caldera in den USA aufgedeckt – etwa zehnmal mehr als bisher aufgezeichnet. Der überarbeitete Katalog, der am 18. Juli 2025 in Science Advances veröffentlicht wurde, wurde von Forschern der Western University, der Universidad Industrial de Santander und des US Geological Survey erstellt.

Dies stellt eine Verzehnfachung der bisher bekannten Ereigniszahl dar und wurde durch die Anwendung fortschrittlicher Techniken des maschinellen Lernens und eines regionsspezifischen 3D-Geschwindigkeitsmodells ermöglicht.
Die am 18. Juli in Science Advances veröffentlichte Studie wurde von Bing Li von der Western University in Zusammenarbeit mit der Universidad Industrial de Santander (Kolumbien) und dem United States Geological Survey (USGS) geleitet.
Es zeigt, wie künstliche Intelligenz die Erkennungsraten und die Charakterisierung mikroseismischer Aktivitäten in komplexen Vulkanregionen radikal verbessern kann.
Bisher stützte sich die Erdbebenerkennung stark auf manuelle Inspektionen und traditionelle Algorithmen, was den Umfang und die Detailliertheit der seismischen Aufzeichnungen einschränkte. Um diese Einschränkungen zu überwinden, trainierten die Forscher für jede seismische Station im Yellowstone-Netzwerk ein separates KI-Modell.
Dieser Ansatz ermöglichte eine präzise Magnitudenbestimmung, selbst bei sich überschneidenden Schwarmereignissen. In Validierungstests konnte das Modell 83 % der zuvor dokumentierten Erdbeben wiederherstellen und innerhalb von nur zehn Tagen 855 neue Ereignisse identifizieren. Über 99 % davon wurden als echte Erdbeben bestätigt.
Karte und Querschnitte der verlagerten Seismizität. Bildnachweis: Langzeitdynamik von Erdbebenschwärmen in der Yellowstone-Caldera, Manuel A. Florez, Bing Q. Li et al.
Mehr als die Hälfte der Erdbeben ereigneten sich in Form von Schwärmen, also in zeitlich und räumlich gehäuften Abfolgen kleiner Erdbeben, denen typischerweise ein dominantes Hauptbeben fehlte.
Diese Schwärme wanderten durch unreife, sehr raue Verwerfungssegmente und nicht durch reife Verwerfungszonen, anders als in seismischen Regionen wie Südkalifornien.
Die Rauheit wurde mithilfe der fraktalen Geometrie quantifiziert, einer Methode zur Messung der Selbstähnlichkeit und räumlichen Unregelmäßigkeit seismischer Aktivitäten.
Statistik gehäufter Seismizität. Bildnachweis: Langzeitdynamik von Erdbebenschwärmen in der Yellowstone-Caldera, Manuel A. Florez, Bing Q. Li et al.
Die Analyse ergab, dass Schwärme wahrscheinlich durch eine Kombination aus langsamer Flüssigkeitswanderung und plötzlichen Druckänderungen in hydrothermalen Systemen ausgelöst wurden.
Die darunterliegenden Verwerfungsstrukturen waren deutlich rauer als jene außerhalb der Caldera, was auf eine aktive Deformation entlang der entstehenden Brüche schließen lässt.
Das Framework für maschinelles Lernen nutzte außerdem ein dreidimensionales seismisches Geschwindigkeitsmodell der Kruste des Yellowstone-Nationalparks.
Vielfalt der Schwarmwanderungsmuster. Bildnachweis: Langzeitdynamik von Erdbebenschwärmen in der Yellowstone-Caldera, Manuel A. Florez, Bing Q. Li et al.
Dieses Modell half dabei, Erdbeben genau zu lokalisieren und ihre Stärke abzuschätzen, indem es Heterogenitäten im Untergrund berücksichtigte, die die Ausbreitung seismischer Wellen beeinflussen.
Die Forscher gehen davon aus, dass die Ergebnisse dazu beitragen könnten, die Gefahrenbewertung in anderen Vulkanregionen zu verbessern und eine sicherere geothermische Entwicklung zu fördern. Dank besserer seismischer Bildgebung lassen sich Gebiete, in denen Flüssigkeitsbewegungen häufig Erdbeben auslösen, leichter meiden.
„Indem wir seismische Muster wie Erdbebenschwärme verstehen, können wir Sicherheitsmaßnahmen verbessern, die Öffentlichkeit besser über potenzielle Risiken informieren und sogar die Entwicklung geothermischer Energie aus Gebieten mit vielversprechendem Wärmefluss aus der Gefahrenzone lenken“, sagte Bing Li.




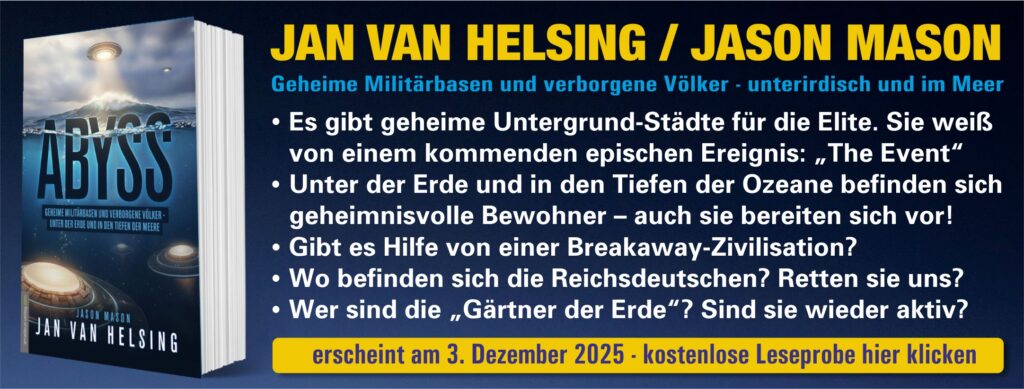
























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.