Die liberale Aufklärungsbewegung richtete sich gegen die staatliche Willkürherrschaft und plädierte für universelle Menschenrechte, verstanden als Abwehrrechte. An der Wurzel der Aufklärung stand der Gedanke des Diskriminierungsverbots für den Staat: Es soll keine gesetzlichen Sonderprivilegien für spezifische Gruppen, Klassen oder Einzelpersonen mehr geben. Alle Menschen sollen vor dem Gesetz gleichbehandelt werden.
(von Olivier Kessler)
Seit einiger Zeit wird dieses liberale Paradigma gehörig auf die Probe gestellt. Mit immer neuen regulatorischen Vorhaben wird versucht, als Antidiskriminierungs-Gesetzgebung zu verkaufen, was einem Vereinigungszwang zwischen Privaten gleichkommt. Die Motivation dahinter – die Gleichstellung aller Mitglieder einer Gesellschaft und der Abbau von Vorurteilen – ist eine löbliche. Auf den ersten Blick mögen gesetzlich verordnete Diskriminierungs-Verbote denn durchaus vernünftig und fortschrittlich klingen. Doch in Wahrheit sind solche Gesetze grossmehrheitlich Symbolpolitik, die durch die Anwendung von Zwang gerade jenen Personen Schaden zufügen, die man besonders schützen möchte.

Die Wirkung von Quoten
Betrachten wir uns zur Veranschaulichung das Beispiel einer Frauenquote in bestimmten Berufen. Nehmen wir an, es gäbe eine Frauenquote bei Chirurgen zur Steigerung der Anzahl Frauen in diesem Beruf. Dies impliziert, dass bei der Besetzung offener Positionen nicht in erster Linie der oder die Fähigste angestellt werden soll, sondern diejenigen Bewerbenden mit dem «passenden» Geschlechtsteil.
Wie würden die Patienten auf diese neue Regel reagieren? Viele würden wohl alles daransetzen, dass sie von einem Mann behandelt werden, der seine Fähigkeiten aufgrund der Frauenquote und der höheren Eintrittshürden für Männer noch stärker unter Beweis stellen musste und daher besonders qualifiziert zu sein scheint. Denn ob eine Chirurgin nun aufgrund ihrer Qualifikation angestellt wurde oder ob es sich um eine weniger qualifizierte, gesetzlich begünstigte Angestellte handelt, weiss kaum jemand.
So werden auch gutqualifizierte Angehörige dieser rechtlich privilegierten Gruppe der angestellten Chirurginnen letztlich stärker diskriminiert und gemieden. Ihre Löhne dürften im Vergleich zu jenen der männlichen Berufskollegen sinken, weil sie für ihre Arbeitgeber weniger Wert schaffen aufgrund der geringeren Kundennachfragen nach ihrer Leistung. Eine solche Gesetzgebung hätte daher ungewollt eine stärkere Diskriminierung von Frauen zur Folge.
Antidiskriminierungs-Gesetze schaffen nicht nur neue Ungerechtigkeiten, sondern verursachen auch einen Schaden am wirtschaftlichen Gefüge und der gesellschaftlichen Koordination. Wenn Unternehmen nicht mehr jene Leute anstellen dürfen, welche sie als am geeignetsten erachten, sondern anhand von staatlich definierten Quoten entscheiden müssen, hat dies zur Konsequenz, dass «die richtigen Leute nicht mehr am richtigen Ort sind», wie es der niederländische Ökonom Frank Karsten formulierte. Die Arbeitsteilung, der die Menschheit zu einem grossen Teil die wachsenden Lebensstandards zu verdanken hat und die zur Folge hat, dass sich jeder auf das konzentriert, was er am besten kann, wird verzerrt und ad absurdum geführt. Die verhängnisvollen Eingriffe in die wirtschaftliche Freiheit schaden insbesondere den Geringverdienern, weil diese bei abnehmender wirtschaftlicher Freiheit verhältnismässig die stärksten Lohneinbussen hinnehmen müssen, wie Studien zeigen.
Auch das Betriebsklima in den Unternehmungen dürfte sich aufgrund sich verschärfender Antidiskriminierungsmassnahmen verschlechtern, weil tendenziell weniger darauf geachtet werden darf, wer am besten ins unternehmerische System und ins bestehende Team passt. Vielmehr schreibt man den Verantwortlichen vor, auf oberflächliche Gruppenmerkmale der Anstellungskandidaten zu schauen, um damit die staatlichen Quotenvorschriften zu erfüllen. Konflikte und Spannungen am Arbeitsplatz dürften daher bei einer erzwungenen Integration unpassender Kandidaten zunehmen.
Grundrechtswidrige Eingriffe
Antidiskriminierungs-Vorschriften, die sich nicht auf die Beziehung zwischen Bürger und Staat, sondern auf das Verhältnis zwischen Privaten beziehen, stellen auch einen Eingriff in elementare Grundrechte dar.
In einer liberalen Gesellschaftsordnung soll jeder seine Ziele und Mittel selbst bestimmen dürfen. Jeder entscheidet eigenverantwortlich, bei wem er einkauft, was er einkauft, mit wem er Handel treibt, zusammenarbeitet, redet, interagiert und zusammenlebt. Solche Entscheide haben allesamt eine Ungleichbehandlung verschiedener Menschen aus verschiedensten Motiven zur Folge. Wenn einige dieser Handlungen nun von Aussenstehenden als «diskriminierend» eingestuft und gesetzlich verhindert werden können, ist die Wahl- und Vertragsfreiheit in Gefahr. Verträge sind dann von gegenseitigem Nutzen, wenn sie freiwillig geschlossen werden: Antidiskriminierungs-Gesetze ersetzen diese Freiwilligkeit zumindest partiell durch Zwang. Sie sind deshalb ein Angriff auf dieses elementare Grundrecht.
Letztlich führen solche Antidiskriminierungs-Vorschriften auch dazu, dass die staatliche Willkür auf Kosten der Rechtsgleichheit ausgedehnt wird. Heute hat jede Person Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür behandelt zu werden. Ein Vereinigungszwang zwischen Privaten gefährdet dieses Grundprinzip. Denn letztlich müssten staatliche Stellen anhand von willkürlichen Kriterien darüber entscheiden, in welchen Bereichen unseres Lebens wir noch frei wählen dürfen und wo unsere Entscheidungen bereits eine «Diskriminierung» im wie auch immer definierten juristischen Sinne darstellen. Ständig würden dann neue Gruppen ins Rampenlicht treten und für sich eine gesetzliche Sonderbehandlung verlangen. Damit würde Schritt für Schritt wieder eine Kastengesellschaft eingeführt mit privilegierten Über- auf der einen und rechtlich benachteiligten Untermenschen auf der anderen Seite.
Eine liberale Gesellschaft wäre keine liberale Gesellschaft mehr, wenn Privaten die Wahl- und Vertragsfreiheit aberkannt würde – auch dann, wenn dies unter dem noblen Vorsatz der Diskriminierungs-Bekämpfung geschieht. Wird die Möglichkeit, frei zu wählen, eingeschränkt oder gar verboten, bedeutet dies, dass jemand anders die Entscheidungen für die Betroffenen trifft: also Politiker und Verwaltungsfunktionäre. Anstelle der Selbstverantwortung tritt die Fremdbestimmung, das staatliche Diskriminierungsverbot würde ausgehebelt und die Ziele der Aufklärung letztlich in ihr Gegenteil verkehrt.
Die Bekämpfung von vorurteilsbeladener, verleumdender Diskriminierung und die Förderung von Toleranz und gesellschaftlicher Inklusion durch Aufklärung und Überzeugung sind gewiss im Sinne einer liberalen Gesellschaft. Ein Vereinigungszwang zwischen Privaten ist es jedoch nicht.
————————
Olivier Kessler ist Vizedirektor des Liberalen Instituts in Zürich.
Quelle: misesde.org

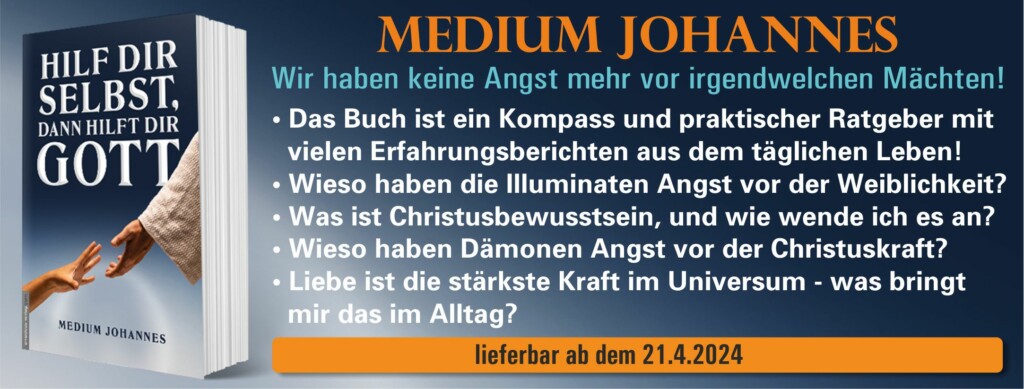




























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.