In den letzten Tagen hat es im Shiveluch, dem größten und aktivsten Vulkan Russlands, eine Reihe von Ausbrüchen in die Stratosphäre auf hoher Ebene gegeben, die am 11. April auf 11 km Höhe gipfelten.
Das Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Anchorage warnte laut volcanodiscovery.com vor einer Aschefahne, die auf geschätzte 11 km ansteigt und in nordwestlicher Richtung driftet.
Partikel, die in Höhen über 10 km (32.800 ft) und in die Stratosphäre ausgestoßen werden, verweilen häufig dort, wo sie eine direkte Kühlwirkung auf den Planeten haben.
Vulkanausbrüche sind einer der Hauptantriebe für die nächste globale Abkühlung der Erde. Ihre Aktivität hängt mit einer geringen Sonnenaktivität und dem daraus resultierenden Zustrom kosmischer Strahlen zusammen (mehr dazu weiter unten).

Der jüngste globale Anstieg von Erdbeben und Vulkanausbrüchen ist wahrscheinlich auf den Rückgang der Sonnenaktivität, koronale Löcher, eine abnehmende Magnetosphäre und den Zustrom von kosmischen Strahlen zurückzuführen, die in silikareiches Magma eindringen.
Verminderte Sonnenaktivität als Auslöser verstärkter Eruptionstätigkeit
Als Kandidat, das Innere der Erde zu beeinflussen, kommt die Sonne infrage. Diese durchläuft einen 11 jährigen Aktivitätszyklus, welcher sich sichtbar in der Manifestation von Sonnenflecken widerspiegelt. Während dieser Zeit ist die Sonnenstrahlung minimal. Unterdessen bilden sich besonders viele koronale Löcher, die wir als dunkle Sonnenflecken sehen können. Zudem gibt es längere Perioden ungewöhnlich hoher, oder niedriger Sonnenaktivität.
Während es logisch erscheint, dass ein solares Minima das Klima der Erdatmosphäre beeinflussen kann, ist es weniger augenfällig, wie es sich auf den Erdmantel auswirken soll. Forscher haben die Theorie aufgestellt, dass durch den Rückgang der Sonnenaktivität, die kosmischen Hintergrundstrahlung stärker auf das Erdinnere einwirkt. Diese Strahlung besteht überwiegend aus Neutronen, welche tief in die Erde eindringen können (Über 6.000 Schwarmbeben unter Islands Vulkanen).
Kollidieren diese mit Atomkernen, wird vergleichsweise viel Energie freigesetzt. Erst kürzlich ist es gelungen eine Quelle der kosmischen Hintergrundstrahlung aufzuspüren und tatsächlich eine Neutron-Atom-Kollision zu beobachten und die Energiefreisetzung zu ermitteln. Allerdings treffen Neutronen verdammt selten auf Atome und es ist völlig unklar, ob die freigesetzte Energie reicht, messbare Veränderungen im Erdinneren hervorzurufen.
Grundlage dieser Theorie lieferte ein ungewöhnlich langes Sonnenminimum (Dalton-Minimum), welches eine kleine Eiszeit im späten 18. Jahrhundert ausgelöst haben soll. Diese kleine Eiszeit dauerte bis ins frühe 19. Jahrhundert. In dieser Periode ereigneten sich die katastrophalen Eruptionen von Laki und Tambora.
Ein weiterer kosmischer Auslöser von Eruptionszyklen, könnten besondere Planeten-Konstellationen sein. Normalerweise liegt das gravitative Zentrum (Baryzentrum) des Sonnensystem in der Sonne. Als Mittelpunkt des Sonnensytems drehen sich die Planeten um unser Zentralgestirn. Allerdings haben die Massen der Planeten Einfluss auf die Lage des Baryzentrums. Besonders die Massenreichen Planeten Jupiter und Saturn zerren an dem Schwerpunkt des Systems.
Befinden sich alle Planeten in einem Sektor, dann kann sich das Baryzentrum sogar um bis zu 2 Sonnendurchmesser außerhalb der Sonne verlagern. Diese Veränderung des gravitativen Zentrums des Systems wirkt sich auch auf die Planeten aus. Die Gezeitenkräfte auf der Erde, beeinflussen nicht nur Ebbe und Flut, sondern deformieren auch den gesamten Erdkörper. Änderungen in der Gravitation des Sonnensystems könnten die Reibungsverhältnisse im Erdinneren verändern und zusätzliche Energie in Form von Reibungshitze freisetzen.
Zudem ist es denkbar, dass sich Stress und Strain in der Erdkruste ändern und somit auf bereits vorhandene Magmenkörpern einwirken. Tatsächlich lassen sich einige große Eruptionen der letzten Jahrzehnte mit einer Verlagerung des Baryzentrums außerhalb der Sonne korrelieren. Aber dies könnte natürlich Zufall sein.
Qualitativ sind die Energieänderungen von gravitativen Kräften und Neutronen-Atomen-Kollisionen im Erdinneren nur sehr schwer zu erfassen. Während viele Forscher sagen, die Kräfte seien zu gering, um sich messbar auf das Erdinnere auszuwirken, gebe ich zu bedenken, dass laut Chaos-Theorie kleinste Änderungen in chaotischen Systemen große Auswirkungen haben können. Allerdings ist auch klar, dass das Erdinnere zwar dynamisch ist, dass Änderungen im System aber gebuffert werden und sich nur sehr langsam fortpflanzen.
Wenn sich eine Energiezufuhr im Erdinneren nun auf die Bildung magmatischer Schmelze im oberen Erdmantel auswirken würde, dann würde es Äonen dauern, bis sich diese Änderungen bis zur Erdoberfläche fortpflanzen. Die treibenden Kräfte hinter Vulkanausbrüchen und Erdbeben sind mit der Konvektion plastischen Materials im Erdinneren korreliert. Dieses bewegt sich in Konvektionszellen, welche die Erdkrustenplatten wie auf einem Förderband verschieben. Allerdings sind diese Bewegungen langsam und spielen sich im Bereich weniger Zentimeter pro Jahr ab.
Auch die Bildung neuer Schmelze ist ein recht langwieriger Prozess.
So halte ich es für extrem unwahrscheinlich, dass sich extern verursachte Änderungen im System Erde tatsächlich fast zeitgleich an der Erdoberfläche auswirken. Wenn es eine Beeinflussung gib, dann müsste diese mit vielen Jahren Verzögerung eintreten. Kurzum, die aktuelle Häufung von Vulkanausbrüchen wird sehr wahrscheinlich nicht durch das aktuelle Sonnenminimum verursacht.
Anak Krakatau: Größere Eruption
Am Anak Krakatau ereignete sich eine größere Eruption. Das VAAC meldete gestern Abend Vulkanasche in einer Höhe von 14000 m über dem Meeresspiegel. Aktuelle Meldungen besagen, dass Asche in 6000 m Höhe festgestellt wird. Auf der LiveCam sieht man eine recht hohe Dampfwolke. Nachts sah man glühende Tephra gut 1200 m hoch aufsteigen. In der Eruptionswolke manifestierten sich vulkanische Blitze. Das VSI registrierte 2 seismische Eruptionssignale. Sie dauerten zwischen 74–2284 Sekunden und brachten es auf Amplituden von 40 mm, was mir als zu gering erscheint, denn immerhin handelte es sich um eine der stärksten Eruptionen seit der Kollapsphase im Dezember 2018. Vor- und nach der Eruption wurde harmonischer Tremor aufgezeichnet. Niederfrequenz-Erdbeben zeugen von Magmenaufstieg. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Ausbrüche ist hoch.
Der Krakatau liegt im Sunda Strait, zwischen den beiden indonesischen Inseln Sumatra und Java. Der Eruption voran gingen mehrere schwache-moderate Erdbeben die sich in der Meerenge ereigneten.
Klyuchevskoy eruptiert

Popocatepetl weiter aktiv
Ähnliches gibt es vom Popocatepetl zu berichten. Die Vulkanasche erreicht hier eine Höhe von 6700 m über dem Meeresspiegel. CENAPRED registrierte 2 Explosionen bei denen glühende Tephra über die Flanken verteilt wurden. Die Vulkanologen zeichneten 137 Exhalationen auf und registrierten 266 Minuten Tremor.
Sakurajima: Vulkanische Blitze
Der japanische Feuerberg Sakurajima generierte seit gestern 12 VONA-Meldungen über Aschewolken. Die Vulkanasche stieg bis zu 3700 m hoch auf. Das Besondere ist, dass es wieder zu mindestens einem schönen vulkanischen Gewitter kam. In den Video sieht man zahlreiche Blitze in der Eruptionswolke zucken. In den letzten Monaten kommt es wieder häufiger zu diesem phantastischen Phänomen.
Merapi eruptiert wieder
Auf der indonesischen Insel Java ist der Merapi erneut ausgebrochen. Er förderte eine Aschewolke, die bis auf einer Höhe von 3000 m aufstieg. Die Vulkanologen vom VSI registrierten den Ausbruch in Form eines seismischen Signals. Es hatte eine Maximal-Amplitude von 75 mm und hielt 103 Sekunden an. Es war die 6 Eruption innerhalb von 2 Wochen. Außerdem wurden 12 Asche-Dampf-Exhalationen festgestellt. Interessant sind 8 vulkanische bedingte Erdbeben mit niedriger Frequenz. Sie deuten auf weiteren Magmenaufstieg hin. Daten über das Domwachstum werden seit einiger Zeit nicht mehr kommuniziert, aber ich gehe davon aus, dass der Dom langsam wächst. Die Gefahr pyroklastischer Ströme wird größer.
Kerinci mit Aschewolke
Mit dem Kerinci eruptierte ein weiterer Vulkan Indonesiens. Er liegt auf Sumatra und stieß eine Aschewolke aus. Sie erreichte eine Höhe von 4300 m über dem Meeresspiegel. Kerinci eruptiert nur sporadisch größere Aschewolken, erzeugt aber ständig Asche-Dampf-Exhalationen. Da der höchste Vulkan Indonesiens ein beliebtes Trekking-Ziel ist, wurde um den Gipfel eine 3 km Sperrzone eingerichtet. Wer sie ignoriert begibt sich in Lebensgefahr.
Popocatepetl: Eruptionswolke auf 7000 m
Der mexikanische Vulkan Popocatepetl war gestern sehr aktiv und stieß mehrere Aschewolken aus. Sie stiegen bis auf einer Höhe von 7000 m auf. Das VAAC registrierte 3 explosive Eruptionen. CENAPRED berichtete am Vortag von 2 Ausbrüchen, bei denen Vulkanasche bis zu 2000 m über Kraterhöhe aufstieg. Zudem registrierten die Vulkanologen 171 Asche-Dampf Exhalationen und 133 Minuten Tremor. Über Domwachstum wird derzeit nichts berichtet.
Semeru eruptiert
Der Semeru auf der indonesischen Insel Java stieß eine Aschewolke aus, die bis auf einer Höhe von 4300 m aufstieg. In den letzten Wochen geschah vergleichbares öfters. Das VSI registrierte sogar 62 seismische Signale, die im Zusammenhang mit kleineren Eruptionen standen. Die Signale hatten Amplituden zwischen 10 – 21 mm und dauerten bis zu 160 Sekunden. Darüber hinaus ereigneten sich 10 Schuttlawinen und einige schwache vulkanisch bedingte Erdbeben.
Nevados de Chillan steigert Aktivität
Der chilenische Vulkan Nevados de Chillan steigerte seine Aktivität weiter. Das VAAC Buenos Aires registrierte in den letzten 24 Stunden 5 Aschewolken, die bis auf einer Höhe von 7000 m aufstiegen. Die Eruptionen finden aus dem Krater Nicanor statt, in dem auch ein Lavadom wächst. Sollte er bis über den Kraterrand hinausragen, drohen pyroklastische Ströme. SERNAGEOMIN berichtete zudem von langperiodischen Erdbeben. Sie deuten auf Magmenaufstieg hin. Der gelbe Alarmstatus wird aufrecht gehalten. Die Vulkanologen schließen eine Erhöhung in Bälde nicht aus.
Ätna: Neue Spitze sichtbar
Die Aktivität am Ätna zeigt sich vom Corona-Virus unbeeindruckt. Der Vulkan eruptiert weiterhin aus dem Zentralkrater und arbeitet fleißig an seinem neuen Gipfel. Ein Foto, das vom nordwestlich gelegenem Ort Linguaglossa aus aufgenommen wurde, enthüllt nun den Kegel der über den Kraterrand des Zentralkraters ragt. Wahrscheinlich ist er damit der höchste Punkt des Vulkans.
Die strombolianische Tätigkeit geht weiter, doch die Daten des INGV deuten darauf hin, dass die explosive Tätigkeit etwas abgenommen hat. Ähnliches kann man auch von der effusiven Tätigkeit annehmen, denn die thermische Strahlung wurde in den letzten Tagen nur noch als moderat bezeichnet und liegt unter den hohen Werten im März.
Interessant ist ein Diagramm, das vom INGV in seinem wöchentlichen Bericht veröffentlicht wurde. Es zeigt die Lage der Erdbebenherde in einer Grafik des Vulkans. Die Beben manifestierten sich unter dem Valle del Bove und verlagerten sich in den vergangenen Monaten aus Richtung Gipfelkrater kommend. Die Konzentration an Helium-Isotopen ist seit Mai 2019 ebenfalls deutlich gestiegen. Das Edelgas wird von aufsteigendem Magma freigesetzt. Es würde mich nicht wundern, wenn sich im Tal des Ochsen die nächste Eruptionsspalte öffnen würde. Wann der größere Ausbruch kommt lässt sich allerdings nicht vorhersagen.
Campi Flegrei: Erdbeben M 2,9
Der italienische Calderavulkan Campi Flegrei wurde heute Nacht um 02:50 Uhr Ortszeit von einem Erdbeben der Magnitude 2,9 erschüttert. Das Epizentrum lag am Rand der Solfatara. Der Erdbebenherd wurde in der geringen Tiefe von nur 2,4 km lokalisiert. Es war ein Einzelbeben und trat nicht im Zusammenhang mit einem Erdbebenschwarm auf, was eigentlich typisch wäre. Gestern brachte das INGV Neapel sein wöchentliches Bulletin heraus: in der letzten Woche wurden 19 schwache Erdbeben registriert. Die Erdbebentätigkeit wird von Inflation begleitet/hervorgerufen und betrug 0,7 cm. Seit 2011 hob sich der Boden um 61 cm.
Die Bodenanhebung wird von magmatischen Fluiden verursacht, wobei nicht klar ist, ob es sich um hydrothermale Tiefenwässer, oder um Magma handelt. Neue Studien tendieren dahin, dass tatsächlich Magma unter dem Vulkan aufsteigt. Einige Kollegen vergleichen die aktuelle Situation mit jener in den 1980iger Jahren. Damals verursachte die Bodenanhebung große Schäden in der Altstadt von Pozzuoli.
Quellen: PublicDomain/electroverse.net/vulkane.net am 11.04.2020


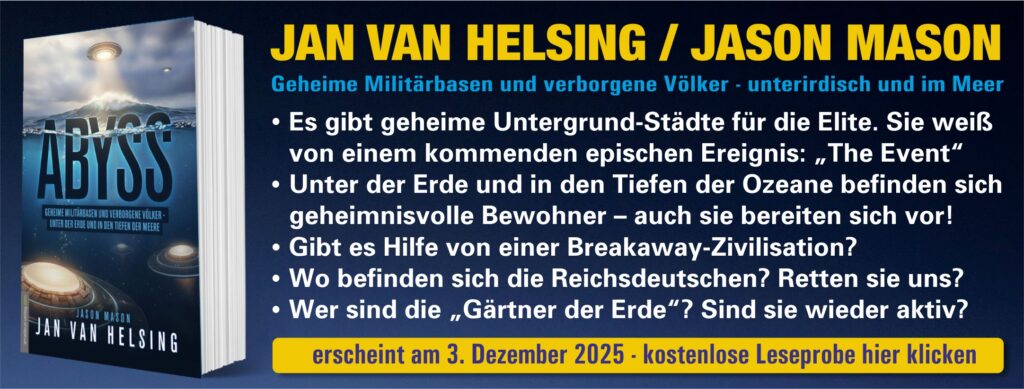
























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.