Welche Geheimnisse bergen die oft als optische Täuschung einer Zeitreise betrachteten Gemälde von Diego Velázquez‘ „Las Meninas“, die noch heute Millionen Menschen auf der ganzen Welt faszinieren?
Las Meninas, spanisch für „Die Hofdamen“, ist ein Gemälde von Diego Velázquez aus dem Jahr 1656, dem führenden Künstler des spanischen Goldenen Zeitalters. Es hängt derzeit im Museo del Prado in Madrid und gilt als eines der bedeutendsten Gemälde der westlichen Kunstgeschichte .
Dieses lebensgroße Gemälde ist mehrere Millionen Dollar wert, misst 318 x 276 cm und zeigt das Leben am Hof des spanischen Königs Philipp IV. Es ist über 350 Jahre her, dass dieses Meisterwerk gemalt wurde, und doch fasziniert es Kunstliebhaber und Kritiker noch immer. Einer Umfrage des Illustrated London News unter Künstlern und Kritikern aus dem Jahr 1985 zufolge wurde Las Meninas zum „größten“ Gemälde der Welt gewählt .

Laut einer 1985 vom Illustrated London News durchgeführten Umfrage unter Künstlern und Kritikern wurde „Las Meninas“ von Diego Velázquez zum großartigsten Gemälde der Welt gewählt.
Werfen wir einen genaueren Blick auf das Gemälde, seine Geschichte und die Emotionen, die es hervorruft, um den Grund dafür herauszufinden.
Wer ist auf dem Gemälde?
Ins Englische übersetzt bedeutet „Las Meninas“ „Die Trauzeuginnen“. Wenn Sie sich Velázquez‘ Gemälde von 1656 oben ansehen, können Sie erkennen, dass die „Trauzeuginnen“ oder genauer gesagt die „Zofendamen“ eigentlich die beiden älteren Mädchen sind, die die jüngere im Vordergrund ankleiden – die zufällig die Infantin Margarita ist. Die Infantin (die später Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches, deutsche Königin, Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn und Böhmen wurde) ist die Tochter von König Philipp IV. von Spanien im 17. Jahrhundert und seiner zweiten Frau, Königin Mariana.
Neben der Prinzessin stehen ihre beiden Zwerge und ihr Mastiff. Der nächste Zwerg ist eigentlich ein Mann, der zur Unterhaltung der Infantin Margarita ein Frauenkleid trägt. Die beiden älteren Frauen im Hintergrund sind Mitglieder der Höflingsgesellschaft des Königs und behalten die Prinzessin im Auge. In der Tür steht José Nieto de Velázquez, ein weiterer Höfling des Königs.
In einem Spiegel an der Wand (der aber auch ein Gemälde sein könnte, worüber wir später sprechen werden) sind König Philipp IV. und Königin Mariana leuchtend abgebildet. Las Meninas spielt in Velázquez‘ eigenem Atelier, was durch die anderen an den Wänden hängenden Gemälde angedeutet wird – Werke von Peter Paul Rubens, dem Meistermaler, den Velázquez 1628 kennenlernte und den er bekanntermaßen bewunderte. Der Mann an der Staffelei ist Velázquez selbst (manche würden sogar behaupten, dies sei der erste Fotobomber der Geschichte gewesen).
Warum wurde es bemalt?
Was Velázquez ermöglichte, dieses Meisterwerk zu malen, das viele als Höhepunkt seiner Karriere betrachten, ist schlicht und einfach seine Schirmherrschaft. Bevor er König Philipp IV. traf, reiste Velázquez im Jahr 1622 von seinem Zuhause Sevilla nach Madrid und malte ein Porträt des Dichters Luis de Góngora. Später im selben Jahr beorderte Graf-Herzog Olivares Velázquez zurück, um ein Porträt von König Philipp IV. zu malen. Anschließend wurde er zu einem der Hofmaler des Königs ernannt. Laut dem Oxford Dictionary of Art ging Philipp sogar so weit zu erklären, dass „nur Velázquez sein Porträt malen dürfe“. Und so wurde der spanische König Velázquez‘ Mäzen.
Technik und Stil
Mit Velázquez‘ Ernennung zum Hofmaler kam es zu einer Veränderung in seinem künstlerischen Schaffen. Sein früherer Stil war religiöser geprägt, er malte Porträts mit naturalistischen Techniken, verwendete aber auch Licht, um eine geheimnisvolle spirituelle Qualität anzudeuten. Nachdem er seine Arbeit für König Philipp IV. begonnen hatte, verzichtete er auf Religion und Allegorie und war in erster Linie ein Porträtmaler, der sich mit der Realität des Scheins beschäftigte. Er vermenschlichte den König und seine Höflinge in seinen Gemälden durch natürliche Posen, ließ sie aber dennoch majestätisch und anständig wirken – so sehr, dass seine Techniken deutlich anders waren und mehr Anerkennung fanden als die jedes anderen spanischen Hofmalers. Mit zunehmendem Alter lockerte sich Velázquez‘ Pinselführung und wurde sehr frei (vielleicht beeinflusst durch seine beiden Reisen nach Italien). Parallel zu diesem Übergang begann er, König Philipps IV. neue und junge Königin Mariana von Österreich und die königlichen Kinder zu malen. Dies alles führte zu Las Meninas.

Ist Las Meninas eine optische Täuschung, die eine Zeitreise ermöglicht?
Das Auffälligste an Las Meninas ist zweifellos die einzigartige Perspektive. Wir werden sofort von den Blicken des königlichen Kindes, ihres Zwergs und Velázquez selbst an seiner Staffelei mit dem Pinsel in der Hand angezogen. Auf den ersten Blick scheint es, als seien wir ein Teil des Gemäldes und Velázquez malt uns, die Betrachter. Doch wenn wir unseren Blick auf den Hintergrund richten, sehen wir, dass König Philipp IV. und Königin Mariana an der Wand abgebildet sind, und wir wissen nicht, ob ihr gerahmtes Abbild nur ein weiteres Gemälde ist oder ob es ein Spiegel sein soll, der widerspiegelt, dass sie – und nicht wir – die Motive des Gemäldes sind. Es gibt auch eine Theorie, dass die „vierte Wand“ des Gemäldes eigentlich überhaupt nicht durchbrochen wird – dass Velázquez nur das malte, was er auf einem großen, vom Boden bis zur Decke reichenden Spiegel sah, was erklären könnte, warum der Decke in dem Werk so viel Platz eingeräumt wird.
Optisch überrascht es uns: Sind wir am Werk oder nicht?
Rational gesehen wissen wir, dass wir uns nicht in einem Gemälde aus dem Jahr 1656 befinden können. Doch durch Velázquez‘ beispiellosen selbstreflexiven (ich wage zu sagen, postmodernen) Ansatz wird Las Meninas zu einer optischen Täuschung, da die Betrachter nicht bestimmen können, wo sie sich in Bezug darauf positionieren sollen. Dies, kombiniert mit seinem realistischen Stil, zieht uns – fast buchstäblich – in das Atelier eines Hofmalers aus dem 17. Jahrhundert.
Las Meninas ist kein symbolisches Artefakt und hat auch keine tiefe allegorische Bedeutung in Bezug auf Religion oder gesellschaftliche Themen. Das „größte Gemälde der Welt“ ist in Wirklichkeit nur eine Darstellung des wahren Lebens während seiner Zeit. Doch da es darauf abzielt, den Betrachter unsicher zu machen, wo er sich befindet, wird es umso kraftvoller und unvergesslicher. Velázquez hat vielleicht sehr wohl gewusst, dass man ein Publikum am besten fesselt, indem man mit unserem Selbstbild spielt, da wir alle den Dingen, die uns direkt betreffen, mehr Aufmerksamkeit schenken. In Las Meninas sehen wir uns durch die Kombination aus optischer Täuschung und realistischer Darstellung der Geschichte als Teil eines historischen Meisterwerks, das sich so in unser Gedächtnis einprägt.
Der Artikel erschien zuerst hier: anti-matrix.com


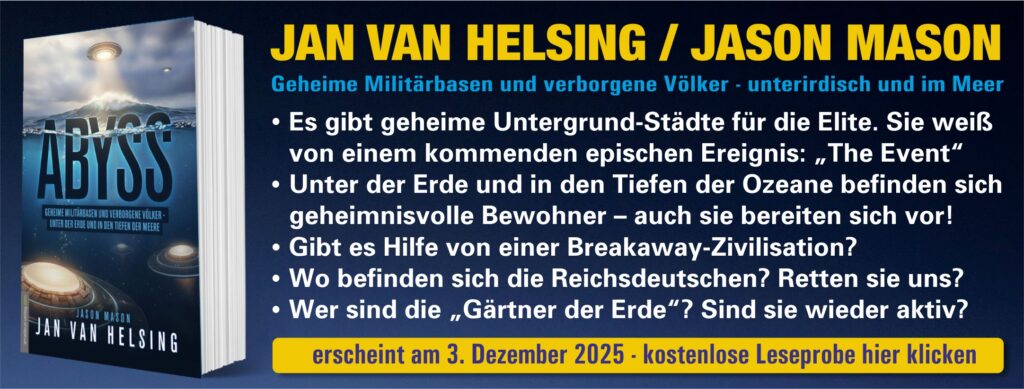
























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.