Das Uno-Menschenrechtsgremium geht davon aus, dass in China mehr als eine Million Uiguren in Haft sind. Und obwohl der UNO das bekannt ist, wurde China trotz des grausamstem Völkermords der Welt, incl. Zwangsabtreibung, Sterilisation und Konzentrationslager, in den UN-Menschenrechtsrat gewählt. Und es betrifft nicht nur die Uiguren, denn in China findet eine Säuberungswelle gegen Religionsgemeinschaften statt.
Nachdem ein unabhängiges Tribunal feststellte, dass die Tötung von Häftlingen in China wegen Organtransplantationen anhält, und dass zu den Opfern inhaftierte Anhänger der verfolgten Falun-Gong-Bewegung gehören, wurde jetzt auch die vollkomme Überwachung der Tujia- und Miao-Stämme aufgedeckt. Ähnlich wie die Uiguren und Tibeter werden die Tujia- und Miao-Stämme als ethnische Minderheitengruppen bezeichnet. Kürzlich ist Chinas Geheimnisse der Gesichtserkennungs- und Überwachung in großem Umfang durchgesickert. Die chinesische Regierung verfolgt die Identität jedes Bürgers – auch der Kinder – bei der Ankunft und beim Verlassen ihrer Häuser. Sie verwandeln die Häuser der Menschen in Gefängnisse. ‚Unsere Seelen sind tot, wie ich ein chinesisches Umerziehungslager für Uiguren überlebte,“ ist die Geschichte einer Frau, die man aus Frankreich lockte und in China wegsperrte.
‚Unsere Seelen sind tot‘: Wie ich ein chinesisches Umerziehungslager für Uiguren überlebte

Nicht nur Chinesen verschwinden plötzlich spurlos, sondern auch ausländische Staatsangehörige. Ist ein Mensch in China plötzlich verschwunden, ist es durchaus möglich, dass dieser sich in einem der vielen chinesischen „Umerziehungslager“ befindet. Schreckliche Bilder zeigen, wie Uiguren gefesselt und mit verbundenen Augen auf dem Boden vor Eisenbahnwaggons sitzen. Eine Flucht ist nicht möglich, denn sie werden von Soldaten bewacht, die sie dann wie Strafgefangene in diese Waggons verladen, mit unbekanntem Ziel. Es sind dramatische Berichte, die uns aus China erreichen. Eine systematische Sterilisation von uigurischen Frauen findet statt. 13 Tonnen Produkte aus menschlichem Haar wurden an der Grenze zu China vom Zoll beschlagnahmt. Es sind Gräueltaten, die schlimmer nicht sein können. Es ist die größte Inhaftierung ethnischer Gruppen und Religionsgemeinschaften, im Grunde seit dem Holocaust, so die Erklärung des Menschenrechtsrates, die von Australien, Neuseeland und weiteren 26 Ländern unterzeichnet wurde, die eine dringende Untersuchung der Menschenrechtssituation in China, insbesondere für Minderheiten, fordern. Siehe: In China findet der grausamste Völkermord der Welt statt! Zwangsabtreibung, Sterilisation, Konzentrationslager – und die Welt schaut zu! – China imposes forced abortion, sterilisation on Uyghurs
Nachdem ich 10 Jahre in Frankreich gelebt hatte, kehrte ich nach China zurück, um einige Papiere zu unterschreiben, und wurde eingesperrt. In den nächsten zwei Jahren wurde ich systematisch entmenschlicht, gedemütigt und einer Gehirnwäsche unterzogen.

Gulbahar Haitiwaji
Diese Geschichte Gulbahar Haitiwaji wurde in The Guardian veröffentlicht, die wir für Sie übersetzt haben.
Der Mann am Telefon sagte, er arbeite für die Ölgesellschaft, „in der Buchhaltung, eigentlich“. Seine Stimme war mir nicht bekannt. Zuerst konnte ich mir keinen Reim darauf machen, weswegen er anrief. Es war November 2016, und ich war von der Firma unbezahlt beurlaubt worden, seit ich China verlassen hatte und zehn Jahre zuvor nach Frankreich gezogen war. In der Leitung herrschte Rauschen, ich konnte ihn kaum verstehen.
„Sie müssen zurück nach Karamay kommen, um die Dokumente für Ihren bevorstehenden Ruhestand zu unterschreiben, Madame Haitiwaji“, sagte er. Karamay war die Stadt in der westchinesischen Provinz Xinjiang, in der ich mehr als 20 Jahre lang für die Ölgesellschaft gearbeitet hatte.
„In diesem Fall würde ich gerne eine Vollmacht erteilen“, sagte ich. „Ein Freund von mir in Karamay kümmert sich um meine Geschäfte. Warum sollte ich für ein bisschen Papierkram zurückkommen? Warum den ganzen Weg für so eine Lappalie gehen? Warum jetzt?“

Der Mann hatte keine Antworten für mich. Er sagte einfach, er würde mich in zwei Tagen zurückrufen, nachdem er die Möglichkeit geprüft hatte, meinen Freund in meinem Namen handeln zu lassen.
Mein Mann, Kerim, hatte Xinjiang 2002 verlassen, um Arbeit zu suchen. Er versuchte es zuerst in Kasachstan, kam aber nach einem Jahr desillusioniert zurück. Dann in Norwegen. Dann in Frankreich, wo er einen Asylantrag gestellt hatte. Sobald er sich dort niedergelassen hätte, würden unsere beiden Mädchen und ich zu ihm ziehen.
Kerim hatte schon immer gewusst, dass er Xinjiang verlassen würde. Der Gedanke hatte sich schon festgesetzt, bevor wir bei der Ölfirma angestellt wurden. Wir hatten uns als Studenten in Urumqi, der größten Stadt der Provinz Xinjiang, kennengelernt und als frischgebackene Hochschulabsolventen mit der Arbeitssuche begonnen. Das war im Jahr 1988. In den Stellenanzeigen in den Zeitungen stand oft ein kleiner Satz im Kleingedruckten: Keine Uiguren. Das ließ ihn nie los. Während ich versuchte, die Beweise der Diskriminierung, die uns überall hin verfolgten, zu übersehen, wurde es bei Kerim zu einer Obsession.
Nach dem Studium wurden uns Jobs als Ingenieure bei der Ölgesellschaft in Karamay angeboten. Wir hatten Glück. Aber dann gab es die Episode mit den roten Umschlägen. Zu Mondneujahr, als der Chef die jährlichen Prämien verteilte, enthielten die roten Umschläge, die den uigurischen Arbeitern gegeben wurden, weniger als die unserer Kollegen, die der dominierenden ethnischen Gruppe Chinas, den Han, angehörten. Bald darauf wurden alle Uiguren aus dem zentralen Büro versetzt und an den Stadtrand verlegt. Eine kleine Gruppe erhob Einspruch, aber ich habe mich nicht getraut.
Als ein paar Monate später eine leitende Position frei wurde, bewarb sich Kerim. Er hatte die richtigen Qualifikationen und das nötige Dienstalter. Es gab keinen Grund, warum er die Stelle nicht bekommen sollte. Aber die Stelle ging an einen Angestellten, der zu einem Han-Arbeiter gehörte, der nicht einmal einen Ingenieurabschluss hatte. Eines Abends im Jahr 2000 kam Kerim nach Hause und verkündete, dass er gekündigt habe. „Ich habe genug“, sagte er.
Was mein Mann erlebte, war nur allzu bekannt. Seit 1955, als das kommunistische China Xinjiang als „autonome Region“ annektierte, werden wir Uiguren als Dorn im Auge des Reichs der Mitte gesehen. Xinjiang ist ein strategischer Korridor und viel zu wertvoll für Chinas regierende kommunistische Partei, um zu riskieren, die Kontrolle darüber zu verlieren. Die Partei hat zu viel in die „neue Seidenstraße“ investiert, das Infrastrukturprojekt, das China über Zentralasien mit Europa verbinden soll, wovon unsere Region eine wichtige Achse ist. Xinjiang ist wesentlich für den großen Plan von Präsident Xi Jinping – das heißt, ein friedliches Xinjiang, offen für Geschäfte, gereinigt von seinen separatistischen Tendenzen und seinen ethnischen Spannungen. Kurz gesagt, ein Xinjiang ohne Uiguren.

Eine pro-uigurische Kundgebung in Hongkong im Jahr 2019. Foto: Jérôme Favre/EPA
Meine Töchter und ich flohen im Mai 2006 nach Frankreich zu meinem Mann, kurz bevor in Xinjiang eine noch nie dagewesene Periode der Unterdrückung begann. Meine Töchter, damals 13 und 8 Jahre alt, erhielten den Flüchtlingsstatus, ebenso wie ihr Vater. Indem er Asyl beantragte, hatte mein Mann einen klaren Bruch mit der Vergangenheit vollzogen. Durch den Erhalt eines französischen Passes verlor er seine chinesische Staatsangehörigkeit. Für mich hatte die Aussicht, meinen Pass abzugeben, eine schreckliche Konsequenz: Ich würde nie wieder nach Xinjiang zurückkehren können. Wie könnte ich mich jemals von meinen Wurzeln verabschieden, von den geliebten Menschen, die ich zurückgelassen hatte – meinen Eltern, meinen Brüdern und Schwestern, ihren Kindern? Ich stellte mir meine Mutter vor, die in die Jahre gekommen war und allein in ihrem Dorf in den nördlichen Bergen starb. Meine chinesische Staatsbürgerschaft aufzugeben, bedeutete auch, [meine Mutter] aufzugeben. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, das zu tun. Also beantragte ich stattdessen eine Aufenthaltsgenehmigung, die alle zehn Jahre verlängert werden konnte.
Nach dem Telefonat schwirrte mein Kopf voller Fragen, während ich mich im ruhigen Wohnzimmer unserer Wohnung in Boulogne umsah. Warum wollte dieser Mann, dass ich nach Karamay zurückkehre? War es ein Trick, damit die Polizei mich verhören konnte? Keinem der anderen Uiguren, die ich in Frankreich kannte, war so etwas passiert.
Der Mann rief zwei Tage später zurück. „Die Erteilung einer Vollmacht ist nicht möglich, Madame Haitiwaji. Sie müssen persönlich nach Karamay kommen.“ Ich gab nach. Immerhin ging es nur um ein paar Dokumente.
„Gut. Ich werde so schnell wie möglich kommen“, sagte ich.
Als ich auflegte, lief mir ein Schauer über den Rücken. Ich fürchtete mich davor, zurück nach Xinjiang zu gehen. Kerim hatte seit zwei Tagen sein Bestes getan, um mich zu beruhigen, aber ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei. Zu dieser Jahreszeit herrschte in der Stadt Karamay ein brutaler Winter. Eisige Windböen heulten durch die Alleen, zwischen den Geschäften, Häusern und Wohnhäusern hindurch.
Ein paar dick eingepackte Gestalten trotzten den Elementen und schmiegten sich an die Mauern, aber im Großen und Ganzen war keine Menschenseele zu sehen. Was ich aber am meisten fürchtete, waren die immer strengeren Maßnahmen, die Xinjiang regulierten. Jeder, der einen Fuß außerhalb seines Hauses setzte, konnte ohne jeglichen Grund verhaftet werden.
Das war nicht neu, aber die Willkür war seit den Unruhen in Urumqi im Jahr 2009, einer Explosion der Gewalt zwischen der uigurischen und der Han-Bevölkerung der Stadt, bei der 197 Menschen starben, noch ausgeprägter geworden. Das Ereignis markierte einen Wendepunkt in der jüngeren Geschichte der Region. Später machte die Kommunistische Partei Chinas die gesamte ethnische Gruppe für diese schrecklichen Taten verantwortlich und rechtfertigte ihre repressive Politik mit der Behauptung, die uigurischen Haushalte seien eine Brutstätte des radikalen Islam und des Separatismus.

Im Sommer 2016 trat ein bedeutender neuer Akteur in den langen Kampf zwischen unserer ethnischen Gruppe und der Kommunistischen Partei ein. Chen Quanguo, der sich mit drakonischen Überwachungsmaßnahmen in Tibet einen Namen gemacht hatte, wurde zum Leiter der Provinz Xinjiang ernannt. Mit seiner Ankunft eskalierte die Unterdrückung der Uiguren dramatisch. Tausende wurden in „Schulen“ geschickt, die fast über Nacht am Rande von Wüstensiedlungen errichtet wurden. Diese waren als Lager mit der Bezeichnung „Transformation durch Bildung“ bekannt. Die Gefangenen wurden dorthin geschickt, um einer Gehirnwäsche unterzogen zu werden – und Schlimmeres.
Ich wollte nicht zurück, aber trotzdem beschloss ich, dass Kerim Recht hatte: Es gab keinen Grund, mir Sorgen zu machen. Die Reise würde nur ein paar Wochen dauern. „Sie werden dich auf jeden Fall zum Verhör mitnehmen, aber keine Panik. Das ist völlig normal“, beruhigte er mich.
Ein paar Tage nach meiner Landung in China, am Morgen des 30. November 2016, ging ich zum Büro der Ölgesellschaft in Karamay, um die besagten Dokumente zu unterschreiben, die mit meiner bevorstehenden Pensionierung zusammenhängen. In dem Büro mit seinen abblätternden Wänden saßen der Buchhalter, ein säuerlicher Han, und seine Sekretärin, zusammengekauert hinter einem Bildschirm.
Der nächste Abschnitt fand in der Polizeistation von Kumlun statt, eine 10-minütige Fahrt vom Firmensitz entfernt. Auf dem Weg dorthin bereitete ich meine Antworten auf die Fragen vor, die mir wahrscheinlich gestellt werden würden. Ich versuchte, mich zu stärken. Nachdem ich meine Habseligkeiten an der Rezeption abgegeben hatte, wurde ich in einen engen, seelenlosen Raum geführt: den Verhörraum. Ich war noch nie in einem gewesen. Ein Tisch trennte die beiden Stühle der Polizisten von meinem eigenen. Das leise Brummen der Heizung, die schlecht geputzte Tafel, die fahle Beleuchtung: das alles gab den Ton an. Wir sprachen über die Gründe, warum ich nach Frankreich gegangen war, über meine Jobs in einer Bäckerei und einer Cafeteria im Geschäftsviertel von Paris, La Défense.
Dann schob mir einer der Beamten ein Foto unter die Nase. Es brachte mein Blut in Wallung. Es war ein Gesicht, das ich so gut kannte wie mein eigenes – diese vollen Wangen, die schmale Nase. Es war meine Tochter Gulhumar. Sie posierte vor dem Place du Trocadéro in Paris, eingemummelt in ihren schwarzen Mantel, den ich ihr geschenkt hatte. Auf dem Foto lächelte sie, in der Hand eine Miniatur-Ostturkestan-Flagge, eine Flagge, die die chinesische Regierung verboten hatte. Für die Uiguren symbolisiert diese Flagge die Unabhängigkeitsbewegung der Region. Der Anlass war eine der Demonstrationen, die vom französischen Zweig des World Uighur Congress organisiert wurden, der die Uiguren im Exil vertritt und sich gegen die chinesische Unterdrückung in Xinjiang ausspricht.

Mitglieder der uigurischen Gemeinschaft und Unterstützer demonstrieren im Jahr 2020 in der Nähe des Eiffelturms in Paris. Foto: Mohammed Badra/EPA
Ob man nun politisiert ist oder nicht, solche Versammlungen in Frankreich sind vor allem eine Chance für die Gemeinschaft, zusammenzukommen, ähnlich wie Geburtstage, das Zuckerfest und das Frühlingsfest Nowruz. Man kann hingehen, um gegen die Unterdrückung in Xinjiang zu protestieren, aber auch, wie Gulhumar es tat, um Freunde zu sehen und die Gemeinschaft der Exilanten zu treffen. Zu dieser Zeit war Kerim ein häufiger Besucher. Die Mädchen gingen ein- oder zweimal. Ich war nie da. Politik ist nicht mein Ding. Seit ich Xinjiang verlassen hatte, interessierte ich mich immer weniger dafür.
 Plötzlich schlug der Beamte mit der Faust auf den Tisch.
Plötzlich schlug der Beamte mit der Faust auf den Tisch.
„Sie kennen sie, nicht wahr?“
„Ja. Sie ist meine Tochter.“
„Ihre Tochter ist eine Terroristin!“
„Nein. Ich weiß nicht, warum sie auf dieser Demonstration war.“
Ich wiederholte immer wieder: „Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was sie dort gemacht hat, sie hat nichts Falsches getan, ich schwöre! Meine Tochter ist keine Terroristin! Und mein Mann auch nicht!“
An den Rest des Verhörs kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich nur an das Foto, ihre aggressiven Fragen und meine vergeblichen Antworten. Ich weiß nicht, wie lange es andauerte. Ich weiß noch, dass ich, als es vorbei war, gereizt sagte: „Kann ich jetzt gehen? Sind wir hier fertig?“ Da sagte einer von ihnen: „Nein, Gulbahar Haitiwaji, wir sind noch nicht fertig.“
‚Rechts! Links! Rührt euch!“ Es waren 40 von uns im Raum, alles Frauen, die blaue Pyjamas trugen. Es war ein unscheinbares, rechteckiges Klassenzimmer. Eine große Metalljalousie mit winzigen Löchern, die das Licht hereinließen, verbarg die Außenwelt vor uns. Elf Stunden am Tag war die Welt auf diesen Raum reduziert. Unsere Pantoffeln quietschten auf dem Linoleum. Zwei Han-Soldaten hielten unerbittlich den Takt, während wir im Raum auf und ab marschierten. Das nannte man „Sportunterricht“. In Wirklichkeit war es gleichbedeutend mit militärischer Ausbildung.
Unsere erschöpften Körper bewegten sich im Gleichschritt durch den Raum, hin und her, von Seite zu Seite, von Ecke zu Ecke. Als der Soldat auf Mandarin „Rührt euch! (Steht bequem)“ brüllte, erstarrte unser Regiment von Gefangenen. Er befahl uns, stillzustehen. Das konnte eine halbe Stunde dauern, genauso oft aber auch eine ganze Stunde oder noch länger. Wenn das der Fall war, begannen unsere Beine überall wie Nadeln zu kribbeln. Unsere Körper, immer noch warm und unruhig, kämpften darum, nicht in der feuchten Hitze zu schwanken. Wir konnten unseren eigenen fauligen Atem riechen. Wir hechelten wie Vieh. Manchmal wurde die eine oder andere von uns ohnmächtig. Wenn sie nicht wieder zu sich kam, zerrte eine Wache sie auf die Füße und schlug sie wach. Wenn sie wieder zusammenbrach, zerrte er sie aus dem Raum und wir sahen sie nie wieder. Nie wieder. Zuerst schockierte mich das, aber jetzt war ich es gewohnt. Man kann sich an alles gewöhnen, sogar an Horror.
Es war jetzt Juni 2017, und ich war seit drei Tagen hier. Nach fast fünf Monaten in den Zellen der Karamay-Polizei, zwischen Verhören und willkürlichen Grausamkeiten – einmal wurde ich zur Strafe 20 Tage lang an mein Bett gekettet, obwohl ich nie wusste, wofür – wurde mir gesagt, dass ich zur „Schule“ gehen würde. Ich hatte noch nie von diesen mysteriösen Schulen gehört oder von den Kursen, die dort angeboten wurden. Die Regierung hat sie gebaut, um Uiguren zu „verbessern“, wurde mir gesagt. Die Frau, die meine Zelle teilte, sagte, es wäre wie eine normale Schule, mit Han-Lehrern. Sie sagte, sobald wir bestanden hätten, könnten die Schüler nach Hause gehen.
Diese „Schule“ befand sich in Baijiantan, einem Bezirk am Rande von Karamay. Nachdem ich die Polizeizellen verlassen hatte, war das alles, was ich an Informationen aus einem Schild herauslesen konnte, das in einem ausgetrockneten Graben hing, in dem ein paar leere Plastiktüten herumtrieben. Offenbar sollte die Ausbildung vierzehn Tage dauern. Danach würde der Theorieunterricht beginnen. Ich wusste nicht, wie ich das durchhalten sollte. Wie hatte ich nicht schon längst zusammenbrechen können? Baijiantan war ein Niemandsland, aus dem sich drei Gebäude erhoben, jedes so groß wie ein kleiner Flughafen. Hinter dem Stacheldrahtzaun gab es nichts als Wüste, so weit das Auge reichte.

Gefesselte Häftlinge mit verbundenen Augen, wahrscheinlich Uiguren, werden 2018 auf einem Bahnhof in Xinjiang verlegt. Foto: War on Fear
An meinem ersten Tag führten mich weibliche Wachen in einen Schlafsaal voller Betten, bloße Bretter aus nummeriertem Holz. Eine andere Frau war bereits dort: Nadira, Koje Nr. 8. Mir wurde die Koje Nr. 9 zugewiesen.
Nadira zeigte mir den Schlafsaal, der nach frischer Farbe roch: den Eimer, in dem man sein Geschäft verrichten konnte und den sie zornig umstieß; das Fenster, dessen Metallladen immer geschlossen war; die beiden Kameras, die in hohen Ecken des Raumes hin und her schwenkten. Das war’s. Keine Matratze. Keine Möbel. Kein Toilettenpapier. Keine Laken. Kein Waschbecken. Nur zwei von uns in der Dunkelheit und das Knallen der schweren Zellentüren, die zuschlagen.
Dies war keine Schule. Es war ein Umerziehungslager, mit militärischen Regeln und dem klaren Wunsch, uns zu brechen. Schweigen wurde erzwungen, aber da wir körperlich bis an die Grenze belastet waren, hatten wir sowieso keine Lust mehr zu reden. Mit der Zeit wurden unsere Unterhaltungen weniger. Unsere Tage wurden durch das Kreischen von Pfiffen beim Aufwachen, bei den Mahlzeiten und beim Schlafengehen unterbrochen. Die Wachen hatten immer ein Auge auf uns; Es gab keine Möglichkeit, ihrer Wachsamkeit zu entkommen, keine Möglichkeit zu flüstern, sich den Mund abzuwischen oder zu gähnen, aus Angst, des Betens beschuldigt zu werden. Es war gegen die Regeln, Essen abzulehnen, aus Angst, als „islamistischer Terrorist“ bezeichnet zu werden. Die Wärter behaupteten, unser Essen sei halal (= nach islamischem Recht erlaubt).
 Nachts kollabierte ich wie betäubt auf meiner Koje. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Es gab keine Uhr. Ich schätzte die Tageszeit danach, wie kalt oder heiß es sich anfühlte. Die Wachen machten mir Angst. Seit unserer Ankunft hatten wir kein Tageslicht mehr gesehen – alle Fenster waren durch diese verdammten Metallfensterläden versperrt. Einer der Polizisten hatte mir zwar versprochen, dass ich ein Telefon bekommen würde, aber das bekam ich nicht. Wer wusste, dass ich hier festgehalten wurde? Hatte man meine Schwester benachrichtigt, oder Kerim und Gulhumar? Es war ein realer Albtraum. Unter den teilnahmslosen Blicken der Überwachungskameras konnte ich mich nicht einmal meinen Mitgefangenen gegenüber öffnen. Ich war müde, so müde. Ich konnte nicht einmal mehr denken.
Nachts kollabierte ich wie betäubt auf meiner Koje. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Es gab keine Uhr. Ich schätzte die Tageszeit danach, wie kalt oder heiß es sich anfühlte. Die Wachen machten mir Angst. Seit unserer Ankunft hatten wir kein Tageslicht mehr gesehen – alle Fenster waren durch diese verdammten Metallfensterläden versperrt. Einer der Polizisten hatte mir zwar versprochen, dass ich ein Telefon bekommen würde, aber das bekam ich nicht. Wer wusste, dass ich hier festgehalten wurde? Hatte man meine Schwester benachrichtigt, oder Kerim und Gulhumar? Es war ein realer Albtraum. Unter den teilnahmslosen Blicken der Überwachungskameras konnte ich mich nicht einmal meinen Mitgefangenen gegenüber öffnen. Ich war müde, so müde. Ich konnte nicht einmal mehr denken.
Das Lager war ein Labyrinth, in dem uns Wachen in Gruppen nach Schlafsälen herumführten. Um zu den Duschen, dem Badezimmer, dem Klassenzimmer oder der Kantine zu gelangen, wurden wir durch eine Reihe endloser, fluoreszierend beleuchteter Gänge geführt. Nicht einmal ein Moment der Privatsphäre war unmöglich. An beiden Enden der Gänge schlossen automatische Sicherheitstüren das Labyrinth wie Schleusen ab. Eines war sicher: Alles hier war neu. Der Geruch von Farbe an den makellosen Wänden erinnerte ständig daran. Es schien das Gelände einer Fabrik zu sein (später sollte ich herausfinden, dass es ein umgebautes Polizeigelände war), aber ich hatte noch keine Vorstellung davon, wie groß es war.
Die schiere Anzahl von Wachen und anderen weiblichen Gefangenen, an denen wir vorbeikamen, als wir herumgeführt wurden, ließ mich glauben, dass dieses Lager riesig war. Jeden Tag sah ich neue Gesichter, zombieartig, mit Tränensäcken unter den Augen. Am Ende des ersten Tages waren wir sieben in unserer Zelle, nach drei Tagen waren es zwölf. Ein bisschen schnelle Mathematik: Ich habe 16 Zellengruppen gezählt, einschließlich meiner, jede mit 12 Kojen, voll belegt … das macht fast 200 Gefangene in Baijiantan. 200 Frauen, die aus ihren Familien gerissen wurden. 200 Leben, eingesperrt bis auf Weiteres. Und das Lager füllte sich weiter.
Man konnte die Neuankömmlinge an ihren verstörten Gesichtern erkennen. Im Flur versuchten sie noch, Ihren Blicken zu begegnen. Diejenigen, die schon länger da waren, schauten auf ihre Füße hinunter. Sie schlurften in engen Reihen herum, wie Roboter. Sie schnappten ohne mit der Wimper zu zucken nach vorn, als ein Pfiff es ihnen befahl. Guter Gott, was hatte man getan, um sie so zu machen?
Ich hatte gedacht, dass die Theoriestunden uns ein wenig Erleichterung von der körperlichen Ausbildung bringen würden, aber sie waren noch schlimmer. Die Lehrerin beobachtete uns ständig und ohrfeigte uns bei jeder Gelegenheit. Eines Tages schloss eine meiner Klassenkameradinnen, eine Frau in den 60ern, ihre Augen, sicher aus Erschöpfung oder Angst. Die Lehrerin gab ihr eine brutale Ohrfeige. „Glaubst du, ich sehe nicht, dass du betest? Du wirst bestraft werden!“ Die Wärter schleppten sie gewaltsam aus dem Raum. Eine Stunde später kam sie mit etwas zurück, das sie geschrieben hatte: ihre Selbstkritik. Die Lehrerin zwang sie, es uns laut vorzulesen. Sie gehorchte, mit aschfahler Miene, und setzte sich wieder. Alles, was sie getan hatte, war, die Augen zu schließen.
Nach ein paar Tagen verstand ich, was die Menschen mit „Gehirnwäsche“ meinten. Jeden Morgen kam eine uigurische Lehrerin in unser stilles Klassenzimmer. Eine Frau unserer eigenen Ethnie, die uns beibrachte, wie man Chinese ist. Sie behandelte uns wie abtrünnige Bürger, die die Partei umerziehen musste. Ich fragte mich, was sie von all dem dachte. Ob sie überhaupt etwas dachte? Woher kam sie? Wie war sie hierher gekommen? War sie selbst umerzogen worden, bevor sie diese Arbeit machte?
Auf ihr Signal hin standen wir alle gemeinsam auf. „Lao shi hao!“ Mit diesem Gruß an die Lehrerin begann der elfstündige tägliche Unterricht. Wir sagten eine Art Treueschwur auf China auf: „Danke an unser großes Land. Danke an unsere Partei. Danke an unseren lieben Präsidenten Xi Jinping.“ Am Abend beendete eine ähnliche Version den Unterricht: „Ich wünsche mir, dass sich mein großes Land entwickelt und eine glänzende Zukunft hat. Ich wünsche mir, dass alle Ethnien eine einzige große Nation bilden. Ich wünsche dem Präsidenten Xi Jinping gute Gesundheit. Lang lebe Präsident Xi Jinping.“
An unsere Stühle geklebt, wiederholten wir unsere Lektionen wie Papageien. Sie lehrten uns die glorreiche Geschichte Chinas – eine gesäuberte Version, bereinigt von Missständen. Auf dem Umschlag des Handbuchs, das wir erhielten, stand „Umerziehungsprogramm“. Es enthielt nichts als Geschichten über die mächtigen Dynastien und ihre glorreichen Eroberungen und die großen Errungenschaften der Kommunistischen Partei. Es war sogar noch politisierter und voreingenommener als der Unterricht an den chinesischen Universitäten. In den ersten Tagen brachte mich das zum Lachen. Dachten sie wirklich, sie würden uns mit ein paar Seiten Propaganda brechen?
Siehe auch dazu: Undercover in einem chinesischen „Umerziehungslager“- Uncovered Details of a Xinjiang Camp in China
Aber als die Tage vergingen, setzte die Müdigkeit ein wie ein alter Feind. Ich war erschöpft, und mein fester Entschluss, Widerstand zu leisten, war auf Dauer nicht zu halten. Ich versuchte, nicht nachzugeben, aber die Schule ging mit Volldampf weiter. Sie rollte direkt über unsere schmerzenden Körper hinweg. Das war also Gehirnwäsche – ganze Tage damit zu verbringen, die gleichen idiotischen Phrasen zu wiederholen. Als ob das noch nicht genug wäre, mussten wir abends nach dem Essen noch eine Stunde extra lernen, bevor wir ins Bett gingen. Wir würden unsere endlos wiederholten Lektionen ein letztes Mal durchgehen.
Jeden Freitag hatten wir einen mündlichen und schriftlichen Test. Abwechselnd trugen wir unter den wachsamen Augen der Lagerleiter den kommunistischen „Eintopf“ vor, den man uns „aufgetischt“ hatte.
Auf diese Weise wurde unser Kurzzeitgedächtnis sowohl unser größter Verbündeter als auch unser schlimmster Feind. Es ermöglichte uns, Bände von Geschichte und Erklärungen über loyale Staatsbürgerschaft aufzusaugen und wiederzukäuen, sodass wir die öffentliche Demütigung durch den Lehrer vermeiden konnten. Aber gleichzeitig schwächte es unsere kritischen Fähigkeiten. Es nahm die Erinnerungen und Gedanken weg, die uns an das Leben binden. Nach einer Weile konnte ich mir die Gesichter von Kerim und meinen Töchtern nicht mehr klar vorstellen. Wir wurden bearbeitet, bis wir nicht mehr als stumme Tiere waren. Niemand sagte uns, wie lange das noch weitergehen würde.
Wie soll ich die Geschichte dessen, was ich in Xinjiang durchgemacht habe, überhaupt beginnen? Wie soll ich meinen Lieben sagen, dass ich der Gewalt der Polizei ausgeliefert war, von Uiguren wie mir, die auf Grund des Status, den ihnen ihre Uniformen verliehen, mit uns, unseren Körpern und Seelen, machen konnten, was sie wollten? Von Männern und Frauen, deren Gehirne gründlich gewaschen worden waren – Roboter, der Menschlichkeit beraubt, eifrig Befehle durchsetzend, kleinliche Bürokraten, die unter einem System arbeiten, in dem diejenigen, die andere nicht denunzieren, selbst denunziert werden, und diejenigen, die andere nicht bestrafen, selbst bestraft werden. Überzeugt, dass wir Feinde seien, die man niederschlagen müsse – Verräter und Terroristen – nahmen sie uns die Freiheit. Sie sperrten uns wie Tiere irgendwo weg vom Rest der Welt, aus der Zeit heraus: in Lager.
In den „Transformation-durch-Erziehung“-Lagern bedeuten Leben und Tod nicht dasselbe wie anderswo. Hundertmal dachte ich, wenn die Schritte der Wachen uns in der Nacht weckten, dass unsere Zeit gekommen war, hingerichtet zu werden. Als eine Hand bösartig eine Schere über meinen Schädel drückte und andere Hände die Haarbüschel, die mir auf die Schultern fielen, wegrissen, schloss ich meine Augen, die von Tränen getrübt waren, und dachte, dass mein Ende nahe war, dass ich für das Schafott, den elektrischen Stuhl, das Ertrinken vorbereitet wurde. Der Tod lauerte in jeder Ecke. Als die Krankenschwestern mich am Arm packten, um mich zu „impfen“, dachte ich, sie würden mich vergiften. In Wirklichkeit haben sie uns sterilisiert. Da verstand ich die Methode der Lager, die Strategie, die verfolgt wurde: uns nicht kaltblütig zu töten, sondern uns langsam verschwinden zu lassen. So langsam, dass es niemand bemerken würde.
Uns wurde befohlen zu verleugnen, wer wir waren. Auf unsere eigenen Traditionen und unseren Glauben zu spucken. Unsere Sprache zu kritisieren. Unser eigenes Volk zu beleidigen. Frauen wie ich, die aus den Lagern kamen, sind nicht mehr die, die wir einmal waren. Wir sind Schatten; Unsere Seelen sind tot. Mir wurde weisgemacht, dass meine Liebsten, mein Mann und meine Tochter, Terroristen waren. Ich war so weit weg, so allein, so erschöpft und entfremdet, dass ich fast damit endete, es zu glauben. Mein Mann Kerim, meine Töchter Gulhumar und Gulnigar – ich prangerte deine „Verbrechen“ an. Ich bat die kommunistische Partei um Vergebung für Gräueltaten, die weder sie noch ich begingen. Ich bereue alles, was ich gesagt habe, was Sie entehrt hat. Heute lebe ich, und ich möchte die Wahrheit verkünden. Ich weiß nicht, ob ihr mich akzeptieren werdet, ich weiß nicht, ob ihr mir verzeihen werdet.
Wie kann ich anfangen zu erzählen, was hier passiert ist?
 Ich wurde zwei Jahre lang in Baijiantan festgehalten. Während dieser Zeit versuchten alle um mich herum – die Polizeibeamten, die kamen, um die Gefangenen zu verhören, plus die Wachen, Lehrer und Tutoren – mir die massive Lüge einzureden, ohne die China sein Umerziehungsprojekt nicht hätte rechtfertigen können: dass Uiguren Terroristen seien und dass ich, Gulbahar, als Uigurin, die seit 10 Jahren in Frankreich im Exil lebt, eine Terroristin sei. Eine Propagandawelle nach der anderen prasselte auf mich ein, und als die Monate vergingen, begann ich, einen Teil meines Verstandes zu verlieren. Teile meiner Seele zerbrachen und brachen ab. Ich werde sie nie wieder erlangen.
Ich wurde zwei Jahre lang in Baijiantan festgehalten. Während dieser Zeit versuchten alle um mich herum – die Polizeibeamten, die kamen, um die Gefangenen zu verhören, plus die Wachen, Lehrer und Tutoren – mir die massive Lüge einzureden, ohne die China sein Umerziehungsprojekt nicht hätte rechtfertigen können: dass Uiguren Terroristen seien und dass ich, Gulbahar, als Uigurin, die seit 10 Jahren in Frankreich im Exil lebt, eine Terroristin sei. Eine Propagandawelle nach der anderen prasselte auf mich ein, und als die Monate vergingen, begann ich, einen Teil meines Verstandes zu verlieren. Teile meiner Seele zerbrachen und brachen ab. Ich werde sie nie wieder erlangen.
Bei heftigen Verhören durch die Polizei machte ich unter den Schlägen einen Kotau – so sehr, dass ich sogar falsche Geständnisse ablegte. Sie schafften es, mich davon zu überzeugen, dass ich, je eher ich meine Verbrechen eingestehe, desto eher ausreisen kann. Erschöpft gab ich schließlich nach. Ich hatte keine andere Wahl. Niemand kann für immer gegen sich selbst kämpfen. Egal, wie unermüdlich man gegen die Gehirnwäsche ankämpft, sie tut ihr heimtückisches Werk. Alle Lust und Leidenschaft verlassen dich. Welche Optionen bleiben dir? Ein langsamer, schmerzhafter Abstieg in den Tod, oder Unterwerfung. Wenn man Unterwerfung spielt, wenn man so tut, als würde man den psychologischen Machtkampf gegen die Polizei verlieren, dann hält man sich trotz allem an den Splitter der Klarheit, der einen daran erinnert, wer man ist.
Ich glaubte kein Wort von dem, was ich ihnen sagte. Ich tat einfach mein Bestes, um eine gute Schauspielerin zu sein.
Am 2. August 2019 sprach mich ein Richter aus Karamay nach einer kurzen Verhandlung vor wenigen Zuhörern für unschuldig. Ich hörte seine Worte kaum. Ich hörte mir das Urteil an, als ob es nichts mit mir zu tun hätte. Ich dachte an all die Male, in denen ich meine Unschuld beteuert hatte, an all die Nächte, in denen ich mich auf meiner Pritsche hin und her gewälzt hatte, wütend darüber, dass mir niemand glauben würde. Und ich dachte an all die anderen Male, als ich die Dinge zugegeben hatte, derer sie mich beschuldigten, all die falschen Geständnisse, die ich gemacht hatte, all die Lügen.
Sie hatten mich zu sieben Jahren Umerziehung verurteilt. Sie hatten meinen Körper gequält und meinen Geist an den Rand des Wahnsinns gebracht. Und jetzt, nach der Überprüfung meines Falles, hatte ein Richter entschieden, dass ich in Wirklichkeit unschuldig war. Ich war frei und konnte gehen.
– Einige Namen wurden geändert. Übersetzt von Edward Gauvin. Dies ist ein bearbeiteter Auszug aus Rescapée du Goulag Chinois (Überlebende des chinesischen Gulag) von Gulbahar Haitiwaji, zusammen mit Rozenn Morgat verfasst und von Editions des Equateurs veröffentlicht.
– Dieser Artikel wurde am 14. Januar geändert, um die Lage der Lager zu klären, die in den letzten Jahren in Xinjiang errichtet wurden, sowie das Lager in Baijiantan, in dem Gulbahar Haitiwaji zuerst festgehalten wurde.
Netzfrau Ursula Rissmann-Telle
Quelle: netzfrauen.org



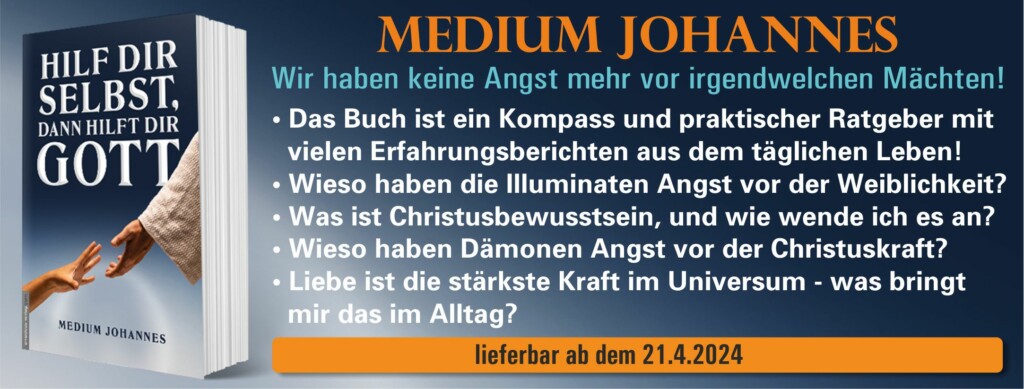




























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.