Dem Reichtum der Aunjetitzer Kultur an der mittleren und oberen Elbe entsprach der Reichtum der Lüneburger und Stader Gruppe an der unteren Elbe. Diese Gruppen hatten sich aus Gruppen der Großsteingräberzeit, wahrscheinlich unter Zuwanderung entwickelt. Das Südufer der Unterelbe hatte offenbar in dieser Zeit hohe strategische und verkehrstechnische Bedeutung.
Hier befanden sich die letzten Ausläufer festen Landes mit Verbindung ins Hinterland und hier kreuzten sich deshalb die an der Küste von Süden nach Norden verlaufenden Landwege mit dem wichtigen Wasserweg der Elbe, der die wichtigen Metallgewinnungsgebiete an der mittleren und oberen Elbe mit dem übrigen atlantischen Reich verband. Die “Stader” stellten Schiffe für den Transport über und entlang der Elbe und Ochsengespanne für den Weg nach Süden über Land. Der Fund von vier Bronzerädern, die einstmals zu Streitwagen gehörten, zeigt, dass auch eine militärische Basis vorhanden war, welche die Handelswege schützte.
Die “Stader” dieser Zeit bestatteten mit Vorliebe in Steinkistengräbern, die mit Erdhügeln bedeckt wurden. Einige dieser Hügelgräber finden sich noch heute am Rande der Geest in erhöhter Lage mit bestem Blick auf das Elbtal. Auch im Hinterland wurden erhöhte Standorte in der welligen Geest zur Anlage von Hügelgräbern bevorzugt. Oft liegen sie hier in Nachbarschaft von Grosssteingräbern, für deren Anlage ähnliche Lagen gewählt wurden. Ähnliches gilt für die südöstlich angrenzende Gruppe der “Lüneburger”. In ihrer Glanzzeit reichte ihr Siedlungsgebiet von der Elbe bis zur Wildeshausener Geest.
Da beide Bereiche in der Blütezeit des atlantischen Reiches wichtige Randgebiete waren, schlug sich seine weitreichende Kultur in bedeutenden Funden nieder. Die Struktur des Landes, die sowohl trockene Sandböden wie auch Moore kennt, sorgte darüberhinaus für den zumindest teilweisen Erhalt von verderblichen Materialien wie Holz, Leder und Textilien. So sind aus der Lüneburger Gruppe Flügelhauben aus Wolle oder Leder bekannt, die jeweils nur vom weiblichen Oberhaupt der Familie getragen werden durften. Sie erinnern mit ihrem reich verzierten fezartigen Mittelstück, an das seitlich ebenfalls verzierte, bis zur Höhe des Kinns reichende Flügel angenäht wurden, an den Kopfschmuck der Pharaonen Ägyptens. Als Oberbekleidung trugen die Frauen steife aus Leder oder Filz gefertigte glockenförmige Umhänge von ponchoartigem Zuschnitt. Sie waren reich mit bronzenem Zierat geschmückt.

Abb. 8 (Bildarchiv Jürgen Hepke)
Dazu wurde je nach Jahreszeit ein längerer oder kürzerer Rock getragen. Der kürzere Rock erlaubte es, ganze Sätze von Beinschmuck vorteilhaft zur Schau zu stellen. Auch gab es offenbar Trägerröcke, die im Sommer bevorzugt getragen wurden. Entsprechend der aus Kreta bekannten Sitte blieb dabei der Busen unbedeckt. Verheiratete Frauen trugen zum Zusammenstecken von Umhängetüchern große bis etwa 30 cm lange Nadeln mit einem radförmigen Schmuck auf einer Seite. Weiterer Frauenschmuck bestand in gemustertem und gerippten Halskragen und sogenannten “Hängescheiben”, die wohl als Dekoration am Gürtel getragen wurden. Halskragen, Radnadeln und Hängescheiben bildeten oft durch gleiche Anordnung der Spiralverzierungen und der Punzen eine zusammengehörende Schmuckgarnitur. (Abb. 9)
Die Männerbekleidung wurde ebenfalls durch bronzene Nadeln zusammengehalten. Sie wiesen aber durchweg weniger Verzierungen auf. Daneben trugen die Männer rechts und links je einen bronzenen Armring. Als Waffen trugen die Männer entweder Absatzbeil und Dolch, beides aus Bronze oder Bogen mit Pfeilköcher und Dolch. Die Kombination Beil mit Pfeil und Bogen fehlt. Entweder war man also Nah- oder Fernkämpfer. Aus den unterschiedlich reich ausgestatteten Gräbern lassen sich deutlich soziale Unterschiede erkennen. Diese drücken sich nach wie vor auch in der Größe der Grabanlage aus.
In der Spätzeit wurden wichtige Tote auch in “Totenhäusern” bestattet, die manchmal mit den Toten verbrannt wurden. Über die Asche türmte man dann den Bestattungshügel. Meistens wurde nur ein Mensch unter einem Hügel bestattet. Es gibt aber auch Gräber von Mutter und Kind, Mann und Frau oder zwei Männern oder sogar von drei und vier Personen unter einem Hügel. Manchmal waren diese gleichzeitig, manchmal auch nacheinander bestattet worden. Eine besondere Bestattungssitte entdeckte man in der Lüneburger Heide und in einem schmalen Streifen entlang der Unterelbe.

Abb. 9 (Bildarchiv Jürgen Hepke)
Hier wurden für einzelne weibliche Personen nach allen Seiten hin offene “Totenhäuser” errichtet. Sie bestanden aus sechs bis acht Pfosten an der Seite und waren überdacht. Man brannte die Häuser während oder nach der Beisetzung nieder und bedeckte sie mit einem Erdhügel. In diesen Gräbern fand man nie den sonst üblichen Frauenschmuck, man nimmt deshalb an, dass es sich um unverheiratete Frauen handelte. Da bekannt ist, dass junge Frauen und Kinder bevorzugt bei Menschenopfern geopfert wurden, kann es sich bei diesen “Toten” um ursprünglich noch Lebende gehandelt haben, die bei Unwettern und Sturmfluten dem Wetter- oder Flussgott als Opfer gebracht wurden, um ihn zu besänftigen. Auch die Bestattung von “gleichzeitig Verstorbenen” in einem Grab kann als Opferung naher Angehöriger verstanden werden. Man spricht hier von der Sitte der “Totenfolge”. Bekanntlich wurde diese Sitte als so genannte “Witwenverbrennung” bis in unsere Zeit in Indien praktiziert und erst zur Zeit der englischen Herrschaft verboten.
Auf Opferriten deuten auch die vielfach aufgefundenen “Rillensteine” hin. Bei ihnen wurde ein Stein, der meist unter einem Meter groß war, mit einer umlaufenden mehrere Zentimeter tiefen Rille versehen, die wohl als Ablauf- oder Sammelrinne gedacht war. Sie wurde oft als Blutrinne bezeichnet. Hier wurden aber wohl nur Tieropfer dargebracht. Irgendwelche Knochenreste wurden im Bereich dieser Steine nicht gefunden. Erhöhte Phosphatwerte im Boden deuten aber auf organische Opfergaben hin. Im Bereich der Stader Gruppe fand man eine Reihe von Gräbern in denen vornehme Krieger bestattet worden waren. Auch daran erkennt man die besondere strategische Bedeutung dieses Raums. Die Gräber enthielten durchweg reiche Grabbeigaben. Als Besonderheit sind reich verzierte Rasiermesser und die Reste eines Klappstuhls aus Holz und Leder, der mit reichem Bronzezierat und Klapperblechen versehen war.

Ähnliche Stühle fand man auch in Jütland und in Nordwestmecklenburg. Sie sind auch aus ägyptischen Pharaonengräbern bekannt. Schwerter waren in dieser Gegend häufige Grabbeigaben. Die Menschen wurden durchweg unverbrannt bestattet. Über dem Grab wurde ein Grabhügel aufgeführt. Als besonderer Fund aus dem Bereich dieser Gruppe gilt neben den bereits erwähnten Streitwagenrädern ein Bildstein mit drei menschlichen Gestalten in eigenartiger Haltung. Einer der dargestellten Menschen hat die Hände wie zum Gebet erhoben und dabei die Finger gespreizt. Der Mensch in der Mitte der Gruppe hält hoch erhoben einen Gegenstand, der ein Beil mit einem langen Schaft oder ein sogenannter “Stabdolch” also ein kultisches Gerät sein kann. Die rechte, abgewandt stehende Figur trägt einen nicht mehr identifizierbaren Gegenstand in den weit vorgestreckten Armen.
Es handelt sich der Haltung nach um eine Gabe, die dargeboten wird. Rechts und links von dieser Figur befinden sich zwei eingetiefte Schälchen. Alle drei Figuren sind nackt und haben vogelartig wirkende Gesichter. Die Darstellung erinnert an nordafrikanische Felsbilder. Vogelartig wirkende Gesichter gibt es auch auf der Narmer-Palette in Ägypten. Es wurde über dieses Bild schon viel spekuliert. Zeitweise sah man darin die drei Götter der Germanen, die von Caesar und Tacitus erwähnt werden. Heute könnte man aktuell sagen, dass sie Ähnlichkeit mit den an anderer Stelle beschriebenen Außerirdischen der Art 1 haben. Eine weitere Besonderheit des nordwestdeutschen Raums sind die hier aufgefundenen sogenannten “Sonnensteine”. (Abb. 11)
Sie bestehen aus großen Feldsteinen, die bis 1m mal 1m groß sind und bis zu 5 t wiegen. Das Material ist meist roter Granit. Auf einer Seite sind sie planiert und tragen hier bis zu 17 konzentrische vertiefte Kreise, meistens haben sie im Zentrum ein Loch oder eine Vertiefung. Auch über ihre Bedeutung weiß man nichts. Möglicherweise hatten sie kultische Bedeutung in der vorangegangenen Grosssteingräberzeit und waren ein Teil eines Grabes, das in christlicher Zeit zerstört wurde.

Abb. 11 (Bildarchiv Jügen Hepke)
Die Exaktheit der Bearbeitung könnte auch auf eine Schablone hinweisen, die bei der Herstellung runder Gegenstände aus Holz oder Metall nützlich war. Während Schmuck im Raum südlich der Elbe meistens aus Bronze angefertigt wurde, wird im Raum nördlich der Elbe, dem damaligen “Bernsteinland”, reichlich Gold für Schmuckgegenstände verwendet.
Dass ein erheblicher Wandel eingetreten war, ist auch an den Produkten aus Bronze der jetzt folgenden Zeit von 1200 v. Chr. bis 800 v. Chr., die man allgemein als Spätbronzezeit bezeichnet, zu sehen. Sie wurden zum großen Teil aus vorhandenen Bronzeteilen durch Umschmelzen gewonnen. Es kam so gut wie keine neue Bronze mehr auf den Markt. Ein Zeichen, dass ein Großteil der Gewinnungs- und Produktionskapazität und offenbar auch das Wissen der Herstellung der Bronze verschwunden war.
Auch der Handel geht auf Grund der weit geringeren Bevölkerungsdichte zurück. Durch die auf die Katastrophe folgende Klimaverschlechterung, die viele Jahrhunderte bis etwa 600 v. Chr. andauern sollte, gab es Missernten und Hungersnöte. Da es keine ordnende Zentralgewalt mehr gab, waren Überfälle auf Nachbarn, bei denen man Vorräte vermutete, nichts ungewöhnliches. Auf der Rhein-Main-Donau Route zogen dazu fremde Volksscharen aus Iberien, England und Frankreich auf dem Weg nach Osten durch das Land und brachten weitere Unsicherheit. Ihr Zugweg ist durch Schwert- und Helmfunde westlichen Ursprungs dokumentiert.

Abb. 12 Bronzebarren aus Depotfund Luitpoldspark, München, Bayern (Bildarchiv Jügen Hepke)
Die Folge war, dass viele der sowieso zerstörten Siedlungen aufgegeben wurden und neue Siedlungen auf schwer zugänglichen Höhen mit aufwendigen Verteidigungsanlagen errichtet wurden. Vieh konnte man im Belagerungsfall in diesen kleinen Siedlungen kaum halten, deshalb verlegte man das Schwergewicht auf den Anbau lagerfähigen Getreides, das am ehesten Schutz vor Hungersnöten bot. Die aufwendigen Bestattungen der vorherigen Zeit waren aus Mangel an freien Arbeitskräften nicht mehr möglich und wurden deshalb nur noch in Einzelfällen praktiziert.
Die jetzt übliche Bestattung war die Verbrennung der Toten und die Beisetzung in nahezu standardisierten Urnen. Man war zu dieser Bestattungsart schon durch die Katastrophe selbst gekommen, denn es gab hier in kurzer Zeit so viele Tote, dass es unmöglich war, sie nach altem Ritus zu bestatten. So gibt es zum Beispiel im Mündungsgebiet der Altmühl in die Donau ein Urnenfeld mit über 1000 Bestattungen. Es zeugt vom hohen Stand der Kultur, dass man diese Toten, die sicher vorwiegend direkte Opfer der Katastrophe waren und hier angeschwemmt wurden, nicht einfach in Massengräbern beigesetzt hat.
Da die Bronze auf Grund des Mangels an Neuproduktion an Bedeutung verlor, wurde wieder mehr und bessere Keramik hergestellt. Werkzeuge wurden wieder aus Stein, Geweih und Knochen angefertigt. Die zur Mangelware werdende Bronze wurde in Depots gehortet, da ihr Wert ständig stieg. Auch die Beraubung vieler Gräber, in denen man wertvolle Bronze vermutete, fiel sicher schon in diese Zeit. Die Bronze wurde nur noch für kleine Teile des täglichen Gebrauchs wie Rasiermesser, Nadeln, Sicheln, Messer und Sägeblätter , die nicht aus anderen Werkstoffen herstellbar waren, verwendet.
Daneben natürlich auch für Waffen, denn von ihnen hing in diesen unruhigen Zeiten oft das Überleben ab. Auch die für diese Zeit zunehmenden Waffenfunde im Gelände zeigen, dass kriegerische Auseinandersetzungen nichts seltenes waren. Der Friede, der in diesem Raum unter der Oberherrschaft des atlantischen Reiches geherrscht hatte, war zu Ende. Damit war auch weitreichender Fernhandel nicht mehr möglich. Wie im Mittelmeerraum war auch im Raum zwischen Nordsee und Alpen eine Epoche zu Ende gegangen.
Anmerkungen und Quellen
Dieser Beitrag (Teil II) von Jürgen Hepke © erschien online zuerst bei tolos.de unter: http://www.tolos.de/nord2.htm
Bild-Quelle
(7 — 12) tolos.de unter: http://www.tolos.de/nord2.htm
Quelle: atlantisforschung.de


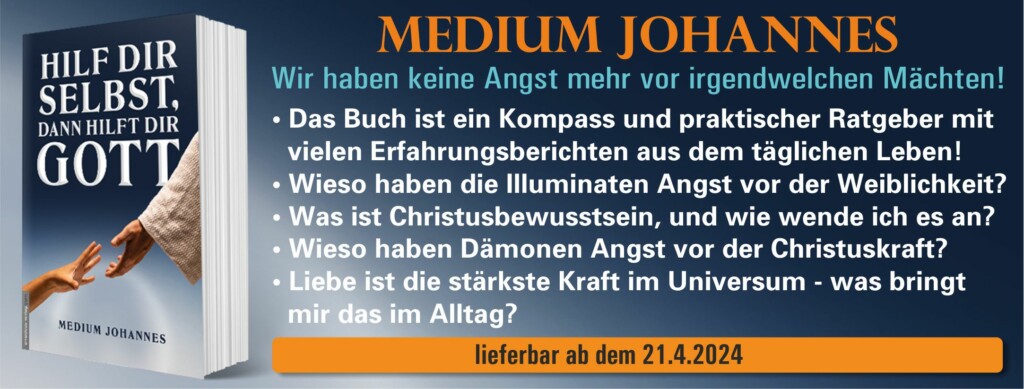




























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.