Ein bahnbrechendes genetisches Modell zeigt, dass „außerirdische Vorfahren“ erstaunliche 30 % unserer DNA beigesteuert haben. Dieser Einfluss der unbekannten Gruppe könnte die menschliche Gehirnleistung enorm gesteigert und unsere Evolutionsgeschichte neu geprägt haben.
Der Co-Autor der Studie, Aylwyn Scally, ein Genetiker an der Universität Cambridge, ist von der Entdeckung begeistert: „Die Tatsache, dass wir Ereignisse von vor Hunderttausenden oder Millionen Jahren allein durch die Untersuchung der DNA heute rekonstruieren können, ist erstaunlich.“

Livescience.com berichtet: In einer am Dienstag (18. März) in der Fachzeitschrift Nature Genetics veröffentlichten Studie stellten Forscher eine neue Methode zur Modellierung genomischer Daten namens „Cobraa“ vor, die es ihnen ermöglicht hat, die Evolution des modernen Menschen (Homo sapiens) nachzuvollziehen.
Dann, vor etwa 300.000 Jahren, vermischte sich Population A mit Population B, wie die Forscher herausfanden. Ihre genetische Analyse legt nahe, dass 80 % des Genoms aller heutigen Menschen von Population A stammen, während 20 % unseres Genoms von Population B stammen.
Einige Gene aus Population B, „insbesondere solche, die mit der Gehirnfunktion und der neuronalen Verarbeitung zusammenhängen, könnten eine entscheidende Rolle in der menschlichen Evolution gespielt haben“, sagte Trevor Cousins, Co-Autor der Studie und Doktorand der Genetik an der Universität Cambridge, in der Erklärung.
Generell reduziere das genetische Material aus Population B die Fähigkeit von Individuen, Kinder zu bekommen, erklärte Cousins gegenüber Live Science in einer E‑Mail, aber „das Genom ist ein komplexer Ort, und Regionen außerhalb der Gene können immer noch wichtige Dinge tun.“
Das neue Modell lege nahe, dass die Population A, aus der schließlich der Mensch hervorging, vor etwa 300.000 Jahren eine „tiefe Struktur“ aufwies, sagte Cousins. Das bedeutet, dass sie aus „zwei oder mehr genetisch unterschiedlichen Populationen entstand, die sich miteinander vermischten“.
Um welche Populationen es sich handelte, ist jedoch unklar. In der Studie stellten die Forscher fest, dass „verschiedene Homo erectus- und Homo heidelbergensis-Populationen, die potenzielle Kandidaten für die Linien A und B sind, im relevanten Zeitraum sowohl in Afrika als auch anderswo existierten.“
Aber „das genetische Modell kann nicht sagen, welche Fossilien der Population A oder B zugeordnet werden sollten“, sagte Cousins. „Wir können nur spekulieren.“

„Das Interessante an dieser Arbeit ist, dass das Muster im Modell eine tiefe afrikanische Struktur aufweist, die alle heute lebenden Menschen teilen“, sagte Hawks. „Es sind keine ‚Geisterpopulationen‘, die zu einer bestimmten Gruppe beitragen, sondern ein einziger großer Geist, der mit der afrikanischen Ursprungspopulation aller modernen Menschen verschmolzen ist.“
Einer der Nachteile des neuen Modells sei jedoch, so Hawks, dass es auf dem 1000-Genome-Projekt basiert, in dem afrikanische Bevölkerungen nur unzureichend repräsentiert seien. „Ich sehe das Modell daher eher als einen Beweis für die Machbarkeit des Prinzips denn als eine wirkliche Anleitung zum Handeln der frühen Menschen“, sagte Hawks.
Der Ursprung des modernen Menschen ist eine seit langem bestehende Frage in der Paläoanthropologie, und Verbesserungen in der DNA- und Genomanalyse in den letzten zwei Jahrzehnten haben neue Erkenntnisse geliefert und neue Fragen aufgeworfen.
„Es wird immer deutlicher, dass die Vorstellung, Arten würden sich in klaren, eindeutigen Abstammungslinien entwickeln, zu simpel ist“, sagte Cousins in der Erklärung. „Kreuzung und genetischer Austausch haben wahrscheinlich immer wieder eine wichtige Rolle bei der Entstehung neuer Arten im gesamten Tierreich gespielt.“
Die ganze Evolutionstheorie ist an den Haaren herbeigezogen, lesen Sie mehr dazu im Buch „Die vergessene Welt der Riesenbäume”.
Zuerst erschienen bei anti-matrix.com.

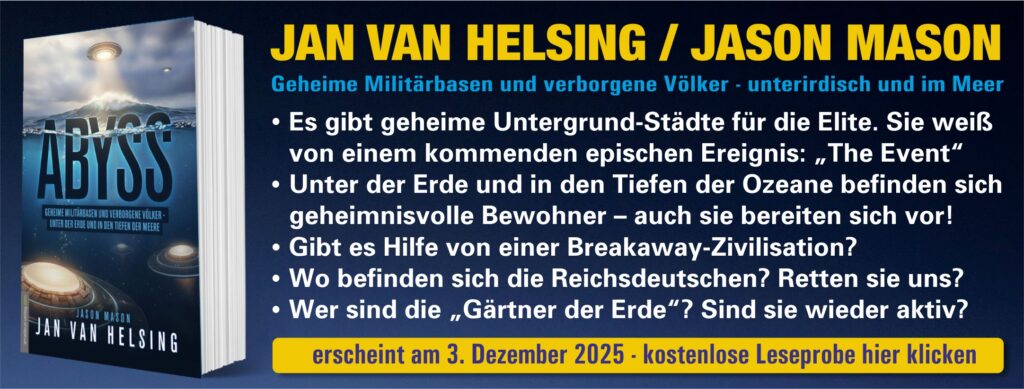
























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.