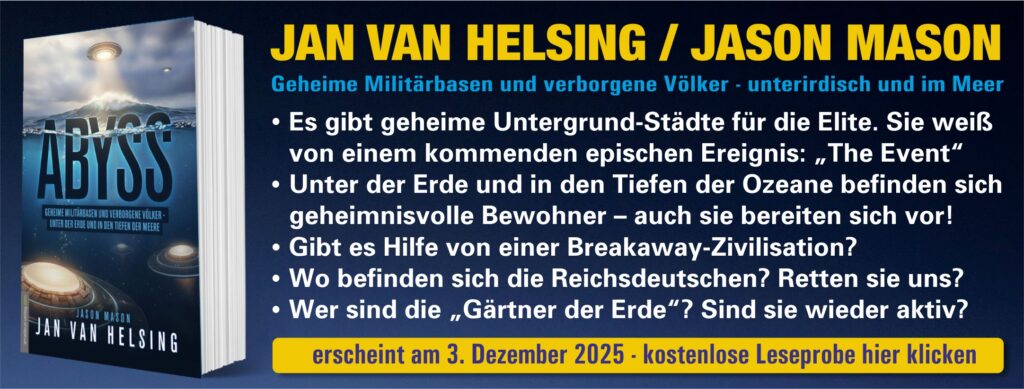Am Neujahrstag, so schreibt der Focus, habe Deutschland zum ersten Mal in seiner Geschichte seinen Strombedarf komplett aus erneuerbaren Energien gedeckt. Man sollte denken, dass das einen Jubelsturm in dem Mainstreammedium hervorruft, scheint dieser Tag doch ein Meilenstein in der Rettung des Klimas und damit des Planeten zu sein. Dieser eine Tag, hat er nicht schon ganz allein Frau Kanzlerins Energiewende gerechtfertigt? Eigentlich erwartet man ja schon ein anrührendes Foto von einem glücklichen Eisbären, der auf einer Eisscholle dahintreibend, ein „Danke, Mutti Merkel!“ Schild hochhält.
Die Schattenseiten der erneuerbaren Energien – reden wir von was anderem
Doch das Frohlocken fällt auffällig zurückhaltend aus, denn es kommt das „Große Aber“: „Doch der Öko-Rekord wird teuer erkauft. Denn die fossilen Kraftwerke laufen als Reservelast weiter – sie können nicht tage- oder stundenweise auf Knopfdruck abgedreht werden.“

Eigentlich ist es kein Interview, sondern die Bundesnetzagentur mietete sich bei der Deutschen Welle einen Herold und Jubelperser, der dem Präsidenten der Bundesnetzagentur die Bühne bereitete und mit zustimmenden Bemerkungen unterstützte. Und eigentlich ist alles prima.
Ideologie contra Realität
Die Stromüberproduktion an sehr windigen Tagen überfordert schlicht das Netz. Und so lesen wir in dem Interview: „… Kopfzerbrechen bereiten diese Erfolge den Betreibern der Stromnetze. Sie müssen immer wieder Anlagen abregeln, weil die Netze sonst überlastet wären, und sie müssen immer häufiger Strom ins Ausland verschenken und manchmal dafür sogar noch eine Prämie zahlen, weil er im Inland nicht gebraucht wird. [ … ] es ist immer häufiger vorgekommen in den letzten Jahren schon und aktuell auch, dass die Stromnetze nicht mehr in der Lage sind, den Strom zu transportieren, der an der Börse verkauft wird. Und das ist eines der Kernprobleme im Rahmen der Energiewende.“
Bundesnetzagenturpräsident Homann ist entweder unbedarft und hat die Implikationen und Konsequenzen der Energiewende noch gar nicht so richtig bemerkt – wovon bei einem Fachmann nicht auszugehen ist, oder er verharmlost bewusst die Probleme, die das EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) mit sich bringt. Das Kostenproblem der „Grundlastfähigen Kraftwerke“ adressiert er überhaupt nicht. Auch nicht die Frage, ob die die anderen EU-Länder denn überhaupt gewillt sind, dem deutschen Energie-Sonderweg bedingungslos zu folgen, gerade in Anbetracht der nicht unerheblichen Probleme und Kosten. Über die wirklichen Probleme und Kosten hätte sich der Redakteur hier einlesen können. Dann hätte er, wenn er es denn gewollt hätte, einen echtes, kritisches Interview führen können.
„Erneuerbare“ und „Dekarbonisierung“ treiben die Energiepreise hoch
Im November 2011 titelte die Frankfurter Allgemeine: „Zwei Billionen für die Energiewende“ und berichtete, zu welchen Ergebnissen Technikwissenschaftler kommen, wenn sie die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung, die „Dekarbonisierung“ (= möglichst gar kein CO2 mehr auszustoßen) und den Wechsel zu erneuerbaren Energien analysieren:
„Auch die potentiellen Kosten haben die Wissenschaftler abgeschätzt. Je nach Höhe des Reduktionsziels von 70 oder 85 Prozent CO2-Minderung gegenüber 1990 dürften sie „im Bereich von 1000 bis 2000 Milliarden Euro liegen“. [ … ] Da das Minderungsziel der Politik allerdings bei 80 bis 95 Prozent liegt, dürften die Kosten mit zwei Billionen Euro deutlich unterschätzt sein.“
Dazu kommt, dass man Reservekapazitäten zu Verfügung halten muss. Scheint weder sie Sonne noch weht der Wind, müssen konventionelle Kraftwerke als „Backup“ bereits am Laufen sein: „Anstelle von Kohlekraftwerken, die aus Gründen des Klimaschutzes stillgelegt werden sollen, müssten demnach Gaskraftwerke in großem Stil als Reserve vorgehalten werden, damit die Stromversorgung auch in Dunkelflauten gesichert bliebe. Die müssten zudem im Lauf der Zeit mit „grünem“ Gas befeuert werden, das künstlich aus Wasserstoff und CO2 erzeugt wird, das zuvor etwa der Atmosphäre entzogen wurde. Offen ist, ob sich solche Kraftwerke für Investoren lohnen oder ob die Kunden für die Versorgungssicherheit eine Art Bereitstellungsgebühr zahlen müssten.“
Das alles ist teuer und ein großer Aufwand. Die Verbraucher bezahlen natürlich auch die Reservekraftwerke über den Strompreis. Könnte man den erzeugten Solar- und Windstrom effektiv und kostengünstig speichern, wären die teuren Reservekraftwerke nicht nötig. Und auch keine negativen Strompreise.

Negative Strompreise entstehen dann, wenn beispielsweise „Starkwind“ über Deutschland zieht und viel mehr Strom produziert, als das Stromnetz aufnehmen kann und gleichzeitig nicht genug verbraucht wird. Ein hinkender, aber anschaulicher Vergleich: Pumpt man Luft in einen Fahrradreifen und merkt, dass der voll aufgepumpt ist, hört man einfach auf. Der Reifen hat den richtigen Druck — und fertig. Hat man aber keine Möglichkeit, die Pumpe abzustellen und von Reifen wegzunehmen, drückt sich immer mehr Luft hinein, und der Reifen zerplatzt. Ein zweites, geöffnetes Ventil kann das verhindern. Die überzählige Luft strömt aus, der Reifen ist gerettet.
Im Prinzip läuft das mit dem Strom und den Netzen auch so. Die Solaranlagen können bei hohem Sonnenlichtaufkommen nicht einfach ab- und nachher wieder angeschaltet werden. Windanlagen werden erst bei starkem Wind abgeschaltet. Aber auch bei Abschaltung von Großwindanlagen und Redispatch-Maßnahmen wird Geld fällig: Im Jahr 2017 kostete die „Abregelung von Windkraftanlagen“ rund eine Milliarde Euro. Der Netzbetreiber schaltet die Windkraftanlage ab, um den Zusammenbruch des Netzes zu verhindern, bekommt aber das Geld, das die Anlage erzeugt hätte, wenn er sie nicht abgeschaltet hätte. Auch das bezahlt der Strom-Endkunde.
Also müssen Stromerzeugungsspitzen, um Schäden am Stromnetz zu vermeiden, irgendwie „ausgeleitet“ werden. Aus diesem Grunde rutschen die Preise an der Strombörse ins Minus. Das heißt, der Anbieter muss sein Netz dringend entlasten und bezahlt auch noch dafür, dass jemand den Strom abnimmt. Der Empfänger der Stromlieferung bekommt Geld dafür, dass er dem Lieferanten aus der Klemme hilft und den Strom obendrauf. Dummerweise bezahlt auch hier der deutsche Verbraucher diesen Preis. Er zahlt eigentlich immer. All diese Kosten werden auf die EEG-Umlagekosten geschlagen und treiben den Strompreis für die deutschen Bürger in die Höhe.
Und es gibt neue Opfer dieser Energiepolitik. Eine im nagelneuen Koalitionsvertrag festgelegte Reform dieser „Netzentgelte“ sollte die Kosten, die durch Reservekraftwerke, Überproduktion, Negative Strompreise und Redispatch-Maßnahmen auf die Stromkunden umgewälzt werden, neu regeln. Die Zauberformel im Koalitionsvertrag heißt: „Die Kosten sollen unter angemessener Berücksichtigung der Netzdienlichkeit verteilt“ (Seite 72 des Koalitionsvertrages) werden. Darunter kann man sich erst einmal nichts vorstellen.
Der Bürger hat den Kanal voll
Hintergrund der “angemessener Berücksichtigung der Netzdienlichkeit” ist: In den Regionen, wo besonders viele Windkraftanlagen stehen und des öfteren weder der Verbraucherbedarf noch die Netze die Windenergie aufnehmen können, bezahlen die Bürger in besonderem Maße die Kosten der Abschaltung und die Kosten der Netzeingriffe über die „Netzkosten“. Gerade in den neuen Bundesländern, wie Brandenburg und MeckVorpomm gibt es viel Windkraft, aber wenig Verbrauch und schlecht ausgebaute Stromnetze. Dort bezahlen die Bürger die höchsten Netzkosten in Deutschland, in Berlin die niedrigsten.
Die Brandenburger zum Beispiel haben die Nase voll von der „Verspargelung“ der Landschaft durch die Windanlagen, die Schäden an der Natur, den Preisverfall der Grundstücke in der Nähe der Windkraftanlagen und die unglaublich hohen Netzkosten. Hier entstehen Bürgerinitiativen von ganzen Dörfern voller zorniger Bürger. Die Groko schafft gerade einen neuen Grund für Protestmärsche.