Am ersten Mai wird bei uns gewandert. Immerhin zehn Kilometer. Entlang der Strecke knipst man mittels an Wegmarken hängender Zangen Löcher in ein kleines Kärtchen und hat man alle beisammen, ist also ohne Abkürzung ans Ziel gelangt, gibt’s ein goldenes Stück Blech zum Umhängen. Die Kinder sind meist stolz wie Oskar, wenn sie behängt mit ihren Medaillen über den Platz laufen, wo die Erwachsenen längst zu Bier, Bratwurst und Maibowle übergegangen sind. Wir nehmen beim Laufen nicht die Zeit, auch wenn die sarkastischen Sprüche beim Überholen langsamer Wanderer natürlich dazu gehören. Die Scherze sind die verblasste Erinnerung daran, dass es bei solchen Gelegenheiten meist darum geht, wer schneller, stärker oder geschickter ist. Wettkampf nennt man das im Sport, Meritokratie heißt das Konzept und wir sind als Gesellschaft gut damit gefahren, den Leistungsgedanken, wenn nicht in allen, so doch in vielen Bereichen nicht ganz aus dem Blick zu verlieren. Beim Maiwandern heißt das: wir laufen nicht sieben, nicht acht, sondern zehn Kilometer. Sonst keine Medaille.

Leistungsdruck vermeiden
Vor einigen Tagen erfuhr man, dass es Regeländerungen bei den nicht wenig gehassten Bundesjugendspielen geben werde, um den Schülern die Demütigung zu ersparen, sich mit anderen Gleichaltrigen im Sport messen zu müssen. Die TAZ titeln in Post-Klassenkampf-Manier „Die Bundesjugendpiele gehören abgeschafft!“
„Beim Wettbewerb wird nicht das einzelne Ergebnis gemessen, sondern – am Beispiel Weitsprung – in welchem vorher fest gelegten Bereich ein Kind gelandet ist. […] Am Grundsatz ändert sich damit wenig, denn es geht weiter darum herauszufinden, wie „gut“ ein Kind ist. Daran wäre wenig auszusetzen, wenn das nicht damit einhergehen würde, dass einigen schwarz auf weiß bescheinigt würde, wie „schlecht“ sie sind.“
Das sei „schwarze Pädagogik“ meint die TAZ und von da ist es nur noch ein Katzensprung bis zum induktiven Schluss, Wettbewerb sei an sich schon irgendwie ein Bisschen „Nazi“.
„Dabei gewinnen bei den Randsportarten nicht selten die Kinder, die sonst immer als Letztes ins Ziel kommen, weil sie sich langsamer und bedächtiger bewegen und nicht vor lauter Ehrgeiz und Bewegungsdrang im Hüpfsack über ihre eigenen Füße stolpern. Nur Letzteres gilt als „sportlich“. Ob jemand gerne auf einen Baum klettert, im Wasser planscht, sich zu Musik bewegt, alleine oder mit anderen: Das spielt keine Rolle, wir sind hier schließlich im Kapitalismus. Höher! Schneller! Weiter! Ganz schlaue Leute wenden ein, die Bundesjugendspiele seien gut für diejenigen, die in allen anderen Fächern mit schlechten Noten gedemütigt werden. Als würde die Unterschrift des Bundespräsidenten diese Verletzungen ausradieren! Und als wären Zahlen und Vergleiche in irgendeiner Weise geeignet, Menschen für etwas zu begeistern.“
Dabei sein ist alles, so sagt man, und Begeisterung möge doch bitte durch Teilnahme entstehen, nicht durch Siege. Die Vorstellung, einem Bundesligaclub beim Fußball zuzusehen, dessen Spieler einfach nur gern gegen Bälle treten und die sich nie an irgendwelchen Leistungsparametern messen lassen mussten, amüsiert mich. TAZ-Autoren würden wohl einwenden, dass dies ja nun etwas gänzlich anderes sei, als bei Bundesjugendspielen in eine Sandgrube zu hüpfen. Das ist richtig, doch wie kommt man von hier nach da ohne Wettbewerb und die bitteren Pillen für viele, denen es an Ausdauer und Talent zum Profi mangelt?
Wie wird man besser in einer Sportdisziplin, einem Handwerk oder einer Wissenschaft, wenn man sich nie ehrlich mit anderen messen will? Wie süß schmeckt ein Sieg, wenn man nie gelernt hat, mit der Bitterkeit einer Niederlage fertig zu werden? „Equity“, dieser politisch korrekte Popanz der Gleichmacherei, erzeugt Mittelmaß und bestraft den, der die Extrameile geht, härter trainiert, talentierter oder einfach nur fleißiger ist. Doch selbst wenn man Noten weglässt und im Sport „Zielkorridore“ weit fasst. die Beteiligten wissen dennoch, wer weiter spring, schneller läuft und der Beste in Mathe ist. Man schafft ja nicht die Unterschiede ab, sondern ignoriert sie oder erklärt sie für irrelevant.
Scheißegal und gute Laune
In der angestrebten post-kompetitiven Gesellschaft genügt es nicht, keinen Ehrgeiz zu entwickeln, man muss auch die Erwartungen senken. Am 12. Juli ist 2023 Schuljahrende in Berlin, der Tag also, an dem die „Giftblätter“ verteilt werden, wie wir früher unsere Zeugnisse nannten. Die Schüler wissen natürlich auch ohne Noten, wer in ihrer Klasse der oder die beste in Mathe, Physik oder Englisch ist. Die Frage, welche Ergebnisse den Fähigkeiten und dem Fleiß des Schülers angemessen sind, obliegt der Einschätzung von Lehrern, Eltern und nicht zuletzt den Schülern selbst. Wir lebten jedoch nicht im besten Deutschland aller Zeiten, wenn sich nicht ein williger Akteur fände, der selbst Unterschiede bei Schulnoten mit Wohlfühlrhetorik glattziehen will. Nur keine Vergleiche, nur kein Wettbewerb, nur keine Verlierer! Ganz vorn dabei in dieser Bewegung und ganz dem Zeitgeist der Unterschiedslosigkeit verschrieben: die evangelische Kirche!
Die lädt im besten Berliner Stadtbezirk Neukölln für den 11.7. zum „Platz 1 für dich – Dein Scheiß auf Noten Segen“ in die Genezarethkirche. Mal abgesehen von der etwas deftigen Formulierung wäre nichts einzuwenden gegen die Botschaft „Noten sind nicht alles“. Aber durch „Platz 1 für dich“ wird es schon für Grundschüler ziemlich eng auf dem Siegertreppchen, auf dem alle unterschiedslos stehen dürfen.
„Jedes Kind erhält ein Erinnerungsfoto und eine Gute-Laune-Medaille.“
Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber wohin man auch schaut, springen einem gleichzeitig Mittelmaß und eine unerklärliche Anspruchshaltung entgegen, die sich aus nichts speist als der eigenen Existenz selbst. Leistungen erbringt man nicht, man erhält sie. Anerkennung wird nicht verdient, sondern „gerecht“ verteilt. Du bist erster und bester, egal was du kannst und zu leisten vermagst. Das mag in einer Religion ein Ideal in Bezug auf Gott praktisch und tröstliches Heilsversprechen sein, eine Gesellschaft, ganz gleich wie egalitär sie ist, lässt sich so nicht organisieren.
Für unsere zukünftigen Chirurgen, Architekten, Piloten und Bundesliga-Fußballer wird hoffentlich nie ein leistungsunabhängiges „Platz 1 für dich“ gelten, verbindet sich doch mit dem Vertrauen, dass man in sie setzen muss, der berechtigte Erwartungsdruck, der gestellten Aufgabe gerecht zu werden. Den muss man aushalten können, sowohl als Kapitän bei der Lufthansa wie als Mannschaftskapitän beim BVB. Wer das nicht kann, muss nach wie vor in die Politik gehen, wo Quote, Proporz und Listenplatz ihre verheerende Wirkung tun.
Irgendwie müssen solche Bedenken auch den Segensverteilern der Genezarethkirche gekommen sein, denn die Seite mit der flapsigen Einladung zum „Ihr-seid-alle-gleich-Fest“ wurde offenbar noch vor Beginn der Veranstaltung vom Netz genommen.
Und nun alle husch husch, zurück ans Projekt „fehlende Fachkräfte ersetzen durch bedingungslose Masseneinwanderung“, um die Folgen der Projekte „ihr seid alle gleich“ und „Leistung darf sich nicht mehr lohnen“ zu bekämpfen.
Quelle: unbesorgt.de


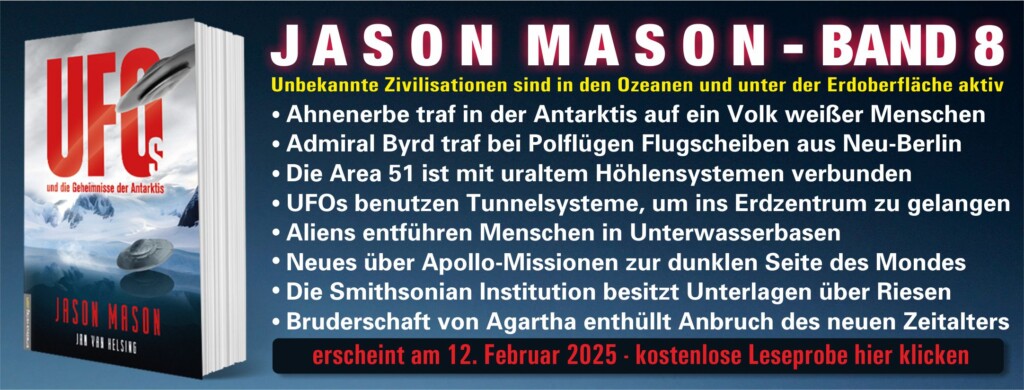



























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.