Hoch im Norden Pakistans, mitten im Hochgebirge, liegt großes, schönes und fruchtbares Tal, das Hunza-Tal. Dort lebt ein kleines Volk fast abgeschnitten vom Rest der Welt. Sie ernähren sich von unverfälschten Nahrungsmitteln, die sie selber anbauen und Tieren, die dort frei herumlaufen und nicht in engen Ställen vegetieren. Als Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen nehmen sie das Gletscherwasser von dem großen Gletscher weiter oben in den Bergen.
Das allein klingt schon wildromantisch. Dazu kommt, dass die Ursprünge und Herkunft der Hunza im Dunkeln liegen. Es ist gar nicht so abwegig, dass sie für sich beanspruchen, Nachfahren Alexander des Großen zu sein. Sie haben nicht nur eine für Pakistan bzw. Indien sehr ungewöhnlich helle Haut, sondern auch einen Typus, der zu einer griechisch-mazedonischen Herkunft passen würde. Die Frauen oben vom Titelbild fielen in Griechenland oder Mazedonien, das Heimatland Alexanders des Großen, überhaupt nicht auf. Die Sprache der Hunzukutz heißt Burushaski. Sie ist aber mit keiner der Sprachen aus diesem Gebiet irgendwie verwandt. Die einzige Sprachverwandtschaft, die Anthropologen gefunden haben ist … Baskisch – was sogar ein bisschen ähnlich klingt, wie „Burushaski“. Diese beiden Sprachen haben auch wiederum Wortverwandtschaften zu bis 70 verschiedenen, alten, kaukasischen Sprachen.
Die Hunzukutz: Ein außergewöhnlich gesundes und langlebiges Völkchen
Berühmt ist dieses kleine Volk in erster Linie dadurch geworden, dass die Entdecker und später Wissenschaftler, Weltenbummler und Ärzte, die in dieses abgelegene Tal reisten, in ihren Berichten immer wieder darauf hinwiesen, wie gesund, ausgeglichen und vor allem langlebig die Hunza (ganz korrekt: Húnzukuc oder Hunzukuts) sind. Übereinstimmende Beschreibungen sagen, dass diese Leute im Schnitt 100 Jahre alt werden, sehr, sehr selten krank werden und die Frauen im Alter von bis zu 80 Jahren noch angeblich Kinder zur Welt bringen können. Sie kennen keinen Krebs und keine Nervenleiden, sind bis ins hohe Alter noch körperlich fit und arbeitsfähig.
Arm und von der Welt total abgeschnitten waren sie nicht, dort in dem Tal – wie es in manchen allzu romantischen Artikeln dargestellt wird. Und auch nicht vollkommen friedlich. Früher, in alter Zeit, waren sie als mutige Krieger – aber auch als draufgängerische Räuber gefürchtet. Denn das Hunzatal war zwar eine schwierige, aber kurze Passage durch’s Hochgebirge, um von den großen Städten Swat nach Gandhara zu gelangen. Da diese uralten Hochgebirgswege sehr schmal waren, mussten die Karawanen den Hunzukuts Abgaben für die Nutzung der schmalen Gebirgspfade und die Durchquerung des Tals zahlen. Und so kam das kleine Volk durchaus zu einem gewissen Wohlstand und an Waren aus aller Welt. Das zeigt auch ihre Festung.
Die Baltit-Burg am Pass des Hunza-Tals, Sitz des „Mir“. Bild: Wikimedia Commons, GNU-Lizenz für freie Dokumentation
Das kleine Volk wurde niemals von Siegern unterjocht. Sogar die Briten, die (nicht nur) ganz Indien unterwarfen und kolonialisierten, konnten 1889 Hunza nicht wirklich erobern. 1892 gelang das mit großer Anstrengung, aber dann zogen die Briten bald wieder ab, es hatte keinen Sinn. Die Hunzukuts waren sich selbst überlassen und lebten seitdem in Selbstverwaltung – wenngleich das Tal heute zu Pakistan gehört. Der Fürst, der „Mir“ war nach China geflüchtet.
Mit dem Bau des Karakorum Highway 1978 kamen plötzlich auch Reisende und sogar Touristen in das Tal. So besuchten auch Ärzte und Wissenschaftler die Hunzukutz, um herauszufinden, was dran ist, an den Berichten von einem Volk der supergesunden Methusalems.
Man mag an einzelnen Geschichten durchaus Zweifel haben, wenn es nur durch Hörensagen überliefert wurde, dass dieser oder jener ein Alter von deutlich über 120 Jahren erreicht hat. Doch aus dem Hunzatal berichten das gleich mehrere, anerkannte Wissenschaftler und es gibt auch Aufzeichnungen, wo Menschen sehr wohl in offizielle Geburtsregister eingetragen wurden, meist kirchliche Stammbücher. So wird in einem sehr alten Buch die Geschichte von Iwan Kußmin, dessen Geburt als Sohn von Leibeigenen des Grafen von Moskau nachweislich 1757 in den offiziellen Geburtsregistern verzeichnet war. Als alter Mann mit 138 Jahren sprach er bei den Behörden vor, um Passpapiere für eine Wallfahrtsreise durch Russland zu machen. Seine Beschreibung ist erstaunlich: „Sein Äußeres entspricht seinem hohen Alter keineswegs, er ist vollkommen rüstig, geistig frisch, spricht verständlich und hört gut.“ Sein Leben war arbeitsreich und fand zumeist in der Natur statt. Nach der Aufhebung der Leibeigenschaft war er ein „freier Ansiedler“. Das heißt, er lebte damals hauptsächlich draußen, atmete frische Luft, trank natürliches Wasser und lebte von seinen selbst erzeugten Lebensmitteln. Später war er Goldwäscher in der Taiga. Also auch ein Mensch, der sehr ursprünglich und in freier Natur lebte, gesunde Luft atmete und gesundes Wasser trank.
Aus einem alten Buch über Naturheilkunde von ca. 1895
Viel Bewegung, Aprikosenkerne und Gletscherwasser
Nicht alles an der Gesundheit der Hunzukutz ist ein Rätsel. In der sauberen, frischen Höhenluft gibt es keine Luftverschmutzung. Das selbst angebaute, weder gespritzte noch mit Gentechnik veränderte Gemüse und Obst bildet einen großen Teil der gesunden Ernährung. Das meiste verzehren sie sogar roh. Die Aprikosen, die dort wunderbar wachsen und gedeihen, sind ein Grundnahrungsmittel der Menschen. Sie legen jedes Jahr eine Art Fastenzeiten ein, in denen sie sich ausschließlich von Aprikosensaft ernähren. Und sie verzehren das ganze Jahr über Aprikosenkerne, das sind die mandelartigen Kerne in der typischen, sehr harten und festen Schale des Steinobstes, wie bei Pfirsichen und Mandeln auch.
Aprikosenkerne enthalten viele Amygdalin (Vitamin B17) oder Laetrile genannt. Es gibt Krebsbehandlungsmethoden mit Laetrile, die aber umstritten sind. Denn Laetril ist eine Vorstufe zu Cyanid und wandelt sich im Körper in Cyanid Blausäure) um, was Krebszellen abtötet, aber gesunde Zellen nicht angreifen soll. Denn nur Krebszellen enthalten das Enzym Beta-Glucosidase, das das Cyanid freisetzt, gesunde Zellen enthalten dagegen Rhodanase, das Blausäure abbaut und „entgiftet“. Kritiker warnen dennoch vor einer schleichenden Blausäurevergiftung.
Die Hunzukutz scheinen aber die lebenden Gegenbeweise zu sein, denn sie essen viel und ausgiebig Aprikosenkerne – und leben – krebsfrei! — besonders lang.
Blühende Aprikosenbäumchen im Hunzatal, im Hintergrund das Bergmassiv des Rakaposhi, Bild: Wikimedia Commons, Nasr Rahman, CC BY-SA 4.0
Bekanntermaßen hält Bewegung jung — und genau das praktizieren die Hunzatal-Bewohner an jedem Tag und in jedem Alter. Die Dörfer sind sehr abgelegen und meist in die Felswände hineingebaut. Manche Dörfer sind mehr als 1.000 Jahre alt. Hunza-Leute haben keine andere Möglichkeit, als die rauen Passagen und steilen Grate zu überwinden. Jeden Tag laufen und klettern sie über das unwegsame Gelände zu ihren Feldern, denn Landstücke, auf denen Anbau möglich ist, sind fast immer nur in einiger Entfernung zu finden. Und bepflanzbares Land ist dort zu wertvoll, um Häuser darauf zu bauen. Weiden für das Vieh sind teilweise zwei Stunden vom Dorf entfernt. Das alles bewältigen die Menschen zu Fuß – und das hält sie auch fit. Angeblich sind die Hunzukutz noch zäher und gesünder, als die Sherpas im Himalaya.
Die dritte, lange missachtete Säule der Gesundheit ist das Gletscherwasser, das einen Großteil des Lebens der Hunzukutz ausmacht. Sie trinken es, bereiten ihre Nahrung damit zu, bewässern ihre Felder und tränken damit ihre Tiere. Der Wissenschaftler Dr. Henri Coanda, ein Pionier der Fluiddynamik, lebte eine ganze Weile bei den Menschen im Hunzatal zusammen. Mit dem jungen Kollegen Dr. Flanagan stellte er Forschungen zu dem Gletscherwasser an.
„Die Brunnen der Jugend“
Dr. Coanda unternahm weite Reisen in Gebiete, in denen Menschen besonders gesund sind und besonders alt werden. Heute werden sie als „blaue Zonen“ bezeichnet. Zum Beispiel ist das die Mongolei oder die japanische Insel Okinawa. Dr. Coanda führte ein Studienbuch, in dem er seine Beobachtungen zu den „Brunnen der Jugend“ notierte. Damit meinte er das Wasser, denn wo er auch auf Regionen mit gesunden, langlebigen Menschen traf, sie alle versicherten ihm überall, dass sie diese Gesundheit durch das Wasser geschenkt bekommen.
Dr. Henri Coanda (rechts) und Dr. Flanagan (links) im Huyck Research Laboratory in Pentaon
Im Hunzatal untersuchte er das blaugrüne, trübe Wasser. Es hatte fast genau die gleichen Eigenschaften, wie destilliertes Wasser und auf seinem Weg einiges an Mineralien angesammelt. Er stellte mehrere Versuche mit dem Hunzawasser an und kam zu dem Schluss, dass das Gletscherwasser im Hunzatal eine ungewöhnliche Molekularstruktur haben müsse und daher die Wirkung der Langlebigkeit verursache. Er beauftragte daraufhin Dr. Flanagan, das Hunzawasser nachzubilden. Nach vielen Versuchen mussten die beiden Wissenschaftler einsehen, dass das so einfach nicht ist. Dennoch konnten sie es mit komplizierten Apparaturen zum Schluss tatsächlich imitieren.
Die Erkenntnis, dass das Wasser eine besondere Struktur aufweisen müsse und dadurch ganz andere Eigenschaften besitze, war völlig richtig. Nur erlebte Dr. Coanda nicht mehr die Lösung dieses Rätsels. Dr. Flanagan nahm diese Aufgabe aber an und entwickelte später mit Dr. Gael, einem Kollegen, eine Methode, mittels Wirbeln und Elektrizität dem Wasser eine solche Struktur zu geben. Er wusste damals nicht, dass er einer Sache auf der Spur war, die heute eine der aufregendsten Wissenschaftszweige geworden ist: Die Wasserforschung und das hexagonale Wasser.
Das Schmelzwasser des Hunza-Gletschers ist uralt – welche Informationen trägt es?
Denn das scheinbar simple Wasser offenbart der Wissenschaft eine Überraschung nach der anderen. So ist Wasser in der Lage, Informationen korrekt und reproduzierbar zu speichern. Es bildet „Cluster“, also so etwas, wie Molekülnester, in der die Wassermoleküle mit einer bestimmten Anordnung und einer Verbindungsstruktur untereinander Informationen fast genauso speichern, wie sich die Bits und Bytes auf einer Computer-Festplatte verhalten. Alles, was dem Wasser „begegnet“, hinterlässt eine Signatur in der Molekülstruktur des Wassers. Und das kann man tatsächlich unter dem Mikroskop sehen.
Wir alle wissen, dass Wassertropfen, wenn sie getrocknet sind, Rückstände hinterlassen, wie einen Stempelabdruck. Auf Fensterscheiben oder schwarzem Autolack oder lackierten Möbeloberflächen, ja sogar auf der Edelstahlspüle kann man den feinen Fleck sehen, den der getrocknete Wassertropfen hinterlassen hat. Spannend wird es, wenn man diese Spuren unter dem Mikroskop betrachtet. Überraschenderweise zeigen sich Strukturen des Wassertropfens, die in dem Trockenabdruck zu erkennen sind.
Das Wasser, was wir trinken, verändert uns
Die Wasserforscher Bernd Kröplin und Regine C. Henschel wollten nun wissen, ob diese Muster rein zufällig auftauchen – oder ob das Wasser hier tatsächlich Informationen gespeichert hat. So legten die beiden Experimentatoren zum Beispiel ein Melissenblatt für eine Weile in Wasser ein. Dann nahmen sie ein paar Tropfen des unbehandelten Wassers (Referenzwasser) und ein paar Tropfen von dem (aus demselben Referenzwasser entnommenen) mit dem Melissenblatt behandelten Wasser. Unter dem Dunkelfeldmikroskop war deutlich zu erkennen, dass die Melissentropfen eine ganz andere Struktur aufwiesen als das unbehandelte Wasser. Aber alle Melissentropfen waren sich untereinander sehr ähnlich – wie auch die Referenzwassertropfen sich ähnlich waren. In den behandelten Wassertropfen entstehen sternförmige Zentren, Blütenartige Strukturen oder leuchtende, schimmernde Ränder.
Dasselbe zeigte sich auch, wenn das Wasser mit unbelebten Dingen zusammenkam, wie bei einem Bergkristall. Sogar bei Kontakt mit Würstchenwasser überraschte das Wasser mit prächtig-eisblumenartigen, gekreuzten Strukturen.

Bild oben links: Ein Tropfen aus dem Wasser, in den ein Bergkristall eingelegt wurde. Rechts aus demselben Wasser, nachdem der Experimentator den Bergkristall in Händen hielt gegessen hat.

Bild oben links: Ein Tropfen aus dem Wasser, in den ein Melissenblatt eingelegt wurde. Rechts aus demselben Wasser, nachdem der Experimentator vom Melissenwasser getrunken hat. Bilder: Bernd Kröplin, Regine Henschel: „Die Geheimnisse des Wassers — Neue erstaunliche Erkenntnisse aus der Wasserforschung“, atVerlag, ISBN 9783038009030, Seite 95
Das erste Ergebnis könnte man sich noch mit winzigen, chemischen Rückständen erklären. Vollends unerklärlich wird es aber, wenn derselbe Experimentator nach dem Auftropfen des Melissenwassers das Melissenblatt isst (ohne dass das Blatt oder der Mensch mit dem Melissenwasser noch einmal in Kontakt gekommen ist), wieder einen Tropfen des „alten“ Melissenwassers auftropft. Die Strukturen sind ähnlich zu ersten Probe, aber wesentlich intensiver ausgebildet. Dasselbe geschieht beim Bergkristallwasser und beim Würstchenwasser. Der Experimentator hatte – ohne jeden neueren Kontakt mit der bereits behandelten Wasserprobe – die Würstchen mit Genuss gegessenen und dann von dem alten Wasser eine Tropfprobe gemacht: Auch hier traten die bereits erkennbaren Eisblumenkreuze noch viel prägnanter auf.
Es muss also eine strukturverändernde Information nicht nur direkt von dem Gegenstand selbst in das Tropfwasser gelangen, sondern offensichtlich erreicht auch die Information aus dem Menschen, der den Gegenstand gegessen hat, das „Gedächtnis“ des Wassers. Denn diese Versuche sind reproduzierbar und unmissverständlich.
So schreiben Kröplin und Henschel (Die Geheimnisse des Wassers, atVerlag, Seite 99):
„Die Sensibilität des Körperwassers, zu dem wir die Flüssigkeiten des Körpers zählen, insbesondere Speichel, Blut, Lymphe und Urin, ist überraschend. Wir erkennen, dass sich die Strukturen in diesen Flüssigkeiten spontan ändern, und dass diese wiederum die Reaktionen der Person verändern (sowohl bewusst als auch unbewusst), wenn eine Information mit der Nahrung oder als Schwingungsinformation von außen hinzugefügt wird. (…) Somit sind wir als Mensch ein hochsensibles System, dessen interne Steuerung unsere Identität bewahrt, aber auch zugänglich ist für verändernde Informationen von außen.“
Das ist nicht nur ein indirekter Beleg dafür, dass Homöopathie und Schüßlersalze eben nicht reine Spinnerei sind, sondern zeigt auch, dass reine Information, also die reine Frequenz eines Feldes im Wasser gespeichert bleibt und wirkt. Genau das ist das grundlegende Prinzip des Tesla-Oszillators, der mit den geeigneten Frequenzen die Körperflüssigkeiten informiert und den Körper befähigt, sich wieder in einen gesunden, harmonischen Zustand zu bringen, die Zellspannung wieder auf das Optimum zu bringen und so Lebens-Energie in jede Zelle zu senden.
Der Eiswasserfluss aus dem Gletscher im Hunzatal. Sein Wasser trägt wahrscheinlich die Informationen, die die Bewohner des Tals so sehr in Harmonie mit der Natur einbettet, dass ihre Gesundheit und Langlebigkeit in diesem Fluss zu suchen ist … was sie selber auch so beschreiben. (Bild: pixabay)
Möglicherweise sind ja auch Informationen aus uralter Zeit in dem Gletschereis gespeichert, die wieder wirksam werden, wenn das Eis schmilzt, zu Wasser wird und sich bewegt. Denn gefrorenes Wasser wird zu einer Momentaufnahme, darin bewegt sich nichts mehr. Die Informationen sind buchstäblich eingefroren.
Es könnte sehr gut sein, dass dieses Wasser Frequenzen und Informationen in die Körper der Leute des Hunza-Tals bringt, die ihre Gesundheit und ihre Langlebigkeit ausmachen. Und Menschen, die von Geburt an in den Urfrequenzen dieses aus Urzeiten unbeschädigten Wassers einer unbelasteten Welt leben, es trinken, ihre Nahrung zubereiten, ihre Felder wässern und ihr Vieh tränken, leben vielleicht tatsächlich noch in einer Art Garten Eden. Die Kinder, die in diesem Frequenzumfeld gezeugt, gestillt und aufgezogen werden – und das seit vielen Generationen – zeigen uns vielleicht nur, wie gesund und vital wir sein könnten, wenn wir in diesem harmonischen Feld der kosmischen Urfrequenzen der Sonne, der Erde und des Wasser leben.
Und das geht mit der Tesla-Hochfrequenztechnologie. Denn schon der geniale und begnadete Erfinder Nikola Tesla hatte das zu seinen Lebzeiten verstanden und angewendet. Er begründete damit und mit seinem Erfinderfreund Georges Lakhovsky einen neuen, sehr erfolgreichen Medizinzweig.
Arthur Tränkle ist Unternehmer, Autor, Referent, Forscher und Entwickler. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Arthur Tränkle mit der Vielfalt von Frequenzen und deren Wirkung auf Zellen.
Auch hat er sich während dieser Zeit mit der natürlichen Wasserbelebung auseinandergesetzt und sich ein großes Fachwissen aneignen können, welches er in seinen Vorträgen und seinen Büchern teilt. Er ist mittlerweile ein hochgeschätzter und bekannter „Tesla- und Lakhovsky-Experte“ und hat einen außerordentlich effektiven, handlichen, zum persönlichen Gebrauch geeigneten Tesla-Oszillator entwickelt.
Wer mehr wissen möchte: Arthur Tränkle gibt Ihnen gerne Auskunft.










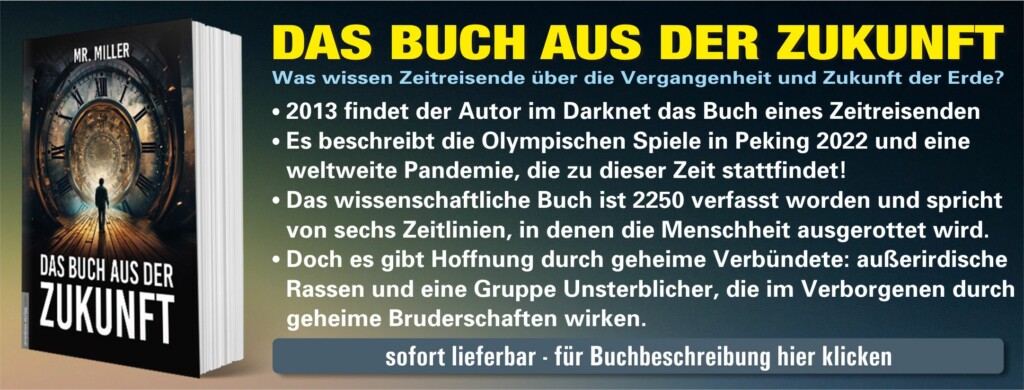



























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.