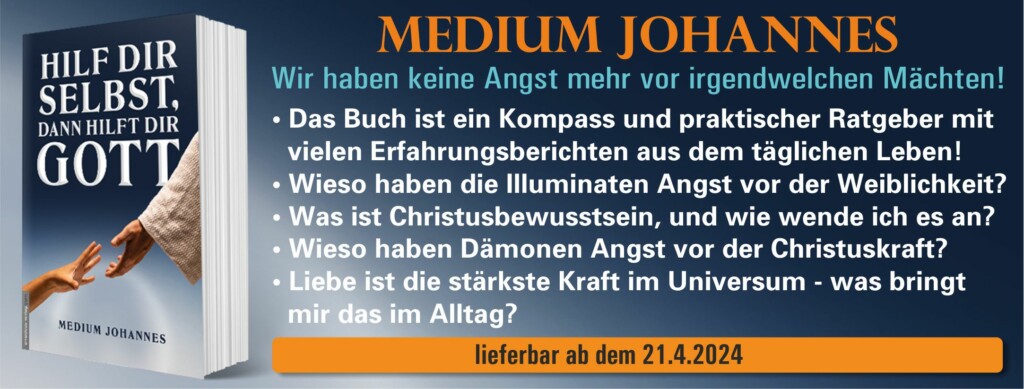Vor einem Jahr noch war das Interesse am Dollar groß, heute ist der Euro der Liebling der Märkte. Wie lange noch?
Zugegeben, der Titel des Beitrages würde noch besser auf den Euro passen. Viele Beobachter – ich gehöre dazu – hätten sich im Jahre 2010 nicht träumen lassen, dass es den Euro heute noch gibt, dass keine Länder aus der Eurozone ausgeschieden sind und schon gar nicht, dass der Euro zum neuen Star am Wechselkurshimmel wird, während der US-Dollar verfällt. Offensichtlich hat der Euro alle Kritiker widerlegt, während der US-Dollar das macht, was er seit Jahrzehnten tut: an Wert verlieren.
Das exorbitante Privileg
Die USA haben ein einmaliges Privileg. Sie verschulden sich massiv für staatlichen und privaten Konsum, importieren seit Jahrzehnten mehr als sie exportieren, bauen dennoch Auslandsvermögen auf und bezahlen für alles in der Weltwährung US-Dollar, die sie beliebig erzeugen können und die trotz nachhaltiger Entwertung immer gefragt bleibt. Donald Trump vergisst diesen Zusammenhang, wenn er über den unfairen Handel klagt. Die USA profitieren in Wahrheit, konsumieren sie doch letztlich umsonst mehr, als sie aus eigenem Einkommen eigentlich könnten.
Wie lange dieses Privileg Bestand hat, muss sich noch erweisen. Ursprüngliche Hoffnungen, der Euro könnte dem US-Dollar Konkurrenz machen, haben sich zerschlagen. Der Euro hat einen Anteil an den Weltwährungsreserven wie früher die D‑Mark. Da französischer Franc, spanische Peseten und selbst italienische Lira früher auch noch eine Rolle spielten, muss man sich eingestehen, dass das Gewicht Europas insgesamt abgenommen hat.
Die Kritiker der US-Dominanz setzen nun auf dem chinesischen Renminbi. In der Tat hat China immer mehr Handelsverträge in eigener Währung abgeschlossen, so zum Beispiel mit Russland. Manche Beobachter sehen in den umfangreichen Goldkäufen der Chinesen (und der Russen) ebenfalls Anzeichen für eine Strategie, die jeweilige Währung international attraktiver zu machen. Dies mag auf lange Sicht erfolgreich sein, vorerst sollten wir die Dominanz des US-Dollar als gegeben ansehen.
Seit einem Jahr unter Druck
Waren sich die Beobachter vor einem Jahr noch sicher, bald die Parität zwischen Euro und Dollar zu sehen, so ist die Stimmung heute – nachdem der Dollar gegenüber dem Euro rund 20 Prozent verloren hat – eine völlig andere. Nach einer mehrjährigen Zwischenerholung scheint der US-Dollar wieder auf den Kurs des dauerhaften und nachhaltigen Verfalls geschwenkt zu sein. Dabei wird er an den Märkten als noch unattraktiver angesehen, als der Euro.
Die Mehrheit der Marktteilnehmer wettet auf einen weiter starken Euro beziehungsweise einen dauerhaft tiefen US-Dollar. Alleine diese Tatsache spricht aus meiner Sicht für eine Erholung des US-Dollars. Aus dem gleichen Grunde – nur in umgekehrter Richtung – habe ich vor einem Jahr auf eine Schwäche des US-Dollars gesetzt. Allerdings hat auch mich das Ausmaß der Dollar-Schwäche bzw. der Euro-Stärke überrascht.
Theoretisch war ein stärkerer Dollar zu erwarten
Dabei waren die Überlegungen, die zur Erwartung eines stärkeren Dollars führten, gar nicht so falsch. Stärkeres Wirtschaftswachstum, anziehende Inflation und ein größerer Finanzierungsbedarf des Staates sollten zu steigenden Zinsen in den USA führen und damit zu einer relativ höheren Attraktivität des US-Dollars. Befördert werden sollte dies durch die Steuerreform in den USA, die nicht nur zu Wirtschaftswachstum, sondern auch zu einer Rückkehr von im Ausland geparktem Geld in die USA führen sollte und damit einer steigenden Nachfrage nach US-Dollar. Nicht zuletzt wurde und wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed ihre Bilanz verkürzt, also als Käufer für Staatsanleihen ausfällt und die Zinsen erhöht. Alles für sich genommen gute Gründe, auf eine steigende Attraktivität des US-Dollars zu setzen.
Dass es anders kam, wird vor allem auf die immer offener protektionistische Politik der US-Regierung zurückgeführt. Da diese lauthals einen schwachen Dollar befürwortet und vor ersten Einschränkungen im Handel nicht zurückschreckt, fürchten die Investoren die Folgen und meiden schon alleine deshalb den US-Dollar. Auch sind Finanzassets außerhalb des Dollarraumes relativ billiger und ziehen damit mehr Investorengelder an, die dann in zweifacher Weise profitieren: von steigenden Preisen und von einem Währungsgewinn. Beide Faktoren haben jedoch nur einen zeitweisen Einfluss auf den Kurs einer Währung. Dauerhaft gelingt es nicht, eine Währung schwach zu reden. Kapitalströme sind ebenfalls nur temporär und legen die Grundlage für künftige Turbulenzen an den Märkten.
Der Dollar Carry-Trade als Zeitbombe
Nicht nur die Investoren schichten Geld aus dem Dollar in andere Währungen um. Auch Schuldner setzen auf eine anhaltende Schwäche und nutzen die (noch) tiefen Zinsen, um sich günstig in US-Dollar zu verschulden. Besonders gefährlich wird es, wenn Schulden in einer Währung aufgenommen werden, um in einer anderen Währung zu spekulieren. Lange Zeit hat man dies mit dem Yen gemacht. Günstige Yen-Kredite wurden dazu genutzt, höher verzinsliche Assets in anderen Währungen zu kaufen. Auch der Schweizer Franken war entsprechend beliebt, wobei gerade die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen, wie gefährlich diese Spekulation – Carry Trade genannt – ist.
Immerhin rund 9.000 Milliarden Dollar Schulden sollen Staaten und Private außerhalb der USA in US-Dollar gemacht haben. Solange die Zinsen tief bleiben und solange der US-Dollar an Wert verliert, ein sicheres Geschäft.
Für die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ist der Wechselkurs des US-Dollars mittlerweile einer der wichtigsten Indikatoren für die Stimmung an den Finanzmärkten. Ein schwacher US-Dollar und ein starker Euro korrespondieren demzufolge mit erhöhter Risikobereitschaft der Akteure. Die Börsen steigen, die Kreditvergabe nimmt zu, vielleicht profitiert gar die Realwirtschaft ein wenig.
So gesehen, passt die Dollarschwäche der letzten zwölf Monate ins Bild. Weltweit hatten wir einen Boom, getragen von billigem Geld und zweifellos zunehmender Risikobereitschaft. Weshalb sonst sollten die liquiden Mittel in den Portfolios der Investoren so gering sein wie noch nie und die Wertpapierkredite („Margin Debt“) so hoch wie noch nie?
Ein steigender Dollar signalisiert der BIZ zufolge eine abnehmende Risikobereitschaft. Gleichzeitig kann ein steigender Dollar zu erheblichen Problemen in den Finanzmärkten führen und damit die Flucht aus dem Risiko verstärken. Assets werden weltweit verkauft, um US-Dollar zu kaufen und Schulden in US-Dollar zu reduzieren. Viele Auslöser für eine solche Entwicklung sind denkbar, von internationalen Konflikten über einen rascher als erwarteten Anstieg der Zinsen in den USA bis zu Zeichen finanzieller Instabilität, die ich vor allem im Bereich der hoch verschuldeten Unternehmen erwarte.
Der Euro gilt als „gerettet“
Richtigerweise ist es nicht nur eine Dollarschwäche, die wir erleben, sondern auch eine Eurostärke. Die Wirtschaft im Euroraum wächst so schnell wie lange nicht mehr, die politischen Signale aus Deutschland gehen in Richtung „Solidarität“ – gemeint ist, dass deutsche Steuerzahler für bankrotte Staaten und Banken einstehen, obwohl sie laut EZB deutlich ärmer sind als die Privathaushalte in Italien, Spanien, Portugal und Frankreich – und der politische Wille an der Währungsunion festzuhalten ist ungebrochen.
Da stört es die Investoren aus aller Welt wenig, dass Länder wie Portugal und Italien und hoch verschuldete Unternehmen im Euroraum weniger Zinsen bezahlen als der amerikanische Staat. Winken doch weitere Währungsgewinne und die Inflationsraten liegen – auch wegen des starken Euro – unter jenen in den USA.
Hinter der Stärke des Euro dürfte außerdem die Erwartung der Investoren stehen, dass die Zinsen auch in Europa früher und stärker steigen. Die EZB dürfte angesichts der offensichtlichen Verbesserungen und der zunehmenden politischen Konvergenz kein Argument haben, die aggressive Geldpolitik fortzusetzen. Damit fällt ein wesentlicher Grund für die tieferen Zinsen weg und das Zinsniveau dürfte sich real dem der USA annähern. Dies vorwegnehmend ist der Euro gestiegen, was aber umgekehrt auch bedeutet, dass es der größte Teil des Anstiegs relativ zum Dollar schon hinter uns liegt.
Die nächste Krise naht
Dabei ist das mit der Stabilität des Euro so eine Sache. Nüchtern betrachtet hat nur die Geldschwemme der EZB, verbunden mit dem Versprechen, niemanden Pleite gehen zu lassen, den Euro bis jetzt am Leben erhalten. Die Vorschläge, die derzeit zur weiteren Stabilisierung durch die Medien geistern, doktern eher an Neben- und Scheinthemen herum und sollen einer vermehrten Umverteilung den Weg bereiten, ohne die eigentlichen Probleme zu lösen.
Aus diesem Grunde dürfte ein Anstieg der Zinsen im Euroraum die alten Probleme wieder aufbrechen lassen. Zu hoch ist die Verschuldung und zu gering bleibt das Wachstum. Die Aufwertung des Euro ist für Länder wie Italien schon jetzt eine Last.
Die Märkte blicken ausgesprochen entspannt auf die Parlamentswahlen in Italien am 4. März. Vielleicht zu unrecht. Die führenden Oppositionsparteien sind Euro-kritisch und sehen gerade in Deutschland eine der Hauptursachen für den Niedergang. Forderungen nach einem Schuldenerlass durch die EZB könnten die Eurokrise über Nacht wieder akut werden lassen.
Prominente Spekulanten wie der größte Hedgefonds Bridgewater wetten mit Milliardenbeträgen gegen italienische Banken und Industrieunternehmen. Eine Wette, die so oder so aufgehen könnte. Im Falle eines Zinsanstiegs ist Italien schnell am Rande der Zahlungsunfähigkeit. Im Falle einer radikalen Anti-Euro-Politik droht ebenfalls der Kollaps an der Börse. Der Euro dürfte jedenfalls deutlich verlieren.
Nur ein erneutes beherztes Eingreifen der EZB, im Sinne einer potenzierten Fortsetzung des „whatever it takes“, würde dann die Lage noch stabilisieren. Damit wäre allerdings der derzeitigen Euro-Stärke ebenfalls die Grundlage entzogen. Das Geldmengen- und Schuldenwachstum würde wieder über dem in anderen Regionen der Welt liegen und der Abwertungswettlauf ginge in die nächste Runde.
Der Dollar vor dem Comeback
Gut möglich also, dass wir vor einer deutlichen Rallye im Dollar stehen, weil die nächste Schwäche im Euro bevorsteht. Aus Investorensicht bedeutet dies, nicht mehr auf den Zug der Dollarpessimisten aufzuspringen und lieber die temporäre Stärke des Euro dazu zu nutzen, in andere Währungen zu diversifizieren. Der US-Dollar ist da sicherlich nicht die erste Wahl. Aber er gehört dazu.
Dr. Daniel Stelter auf www.think-beyondtheobvious.com → WiWo.de: „US-Dollar: Totgesagte leben länger“, 22. Februar 2018