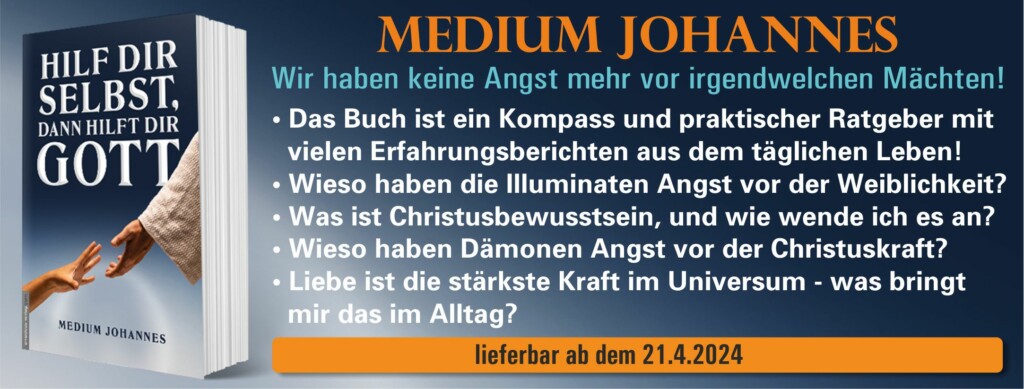Finanz- und Eurokrise wurden in den letzten Jahren erfolgreich unterdrückt. Doch 2019 dürften die Illusionen platzen. Deutschland steht vor einem Schock.
Die Börsen wittern es. Keine der wichtigen Weltbörsen liegt in diesem Jahr noch im Plus. Wie im Frühjahr vorhergesagt, wurde es kein gutes Aktienjahr. Selbst die Wall Street, die bis vor Kurzem noch von den Technologiewerten gezogen wurde, liegt deutlich unter den im Laufe des Jahres erreichten Höchstständen. Die FAANGs, lange die eigentliche Lokomotive des Börsenaufschwungs (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google), haben deutlich nachgegeben und sind nach gängiger Definition mit Verlusten von mehr als 20 Prozent in einem Bärenmarkt. Wichtige charttechnische Hürden wurden durchbrochen und der Weg nach unten ist offen. Daran würde auch eine etwaige Jahresendrallye nichts ändern.
Derweil mehren sich die Anzeichen, dass der Konjunktur in der Eurozone der Schwung ausgeht. Die Stimmung der Einkaufsmanager, gemessen am IHS Markit Eurozone Composite PMI ist im November auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen, im Subsegment der Industrie gar auf ein Niveau, das für eine Rezession spricht. Besonders getroffen von der Entwicklung sind Italien und Deutschland. In Italien mag man es mit der Unsicherheit bezüglich der neuen Regierung und der Spannungen, die mit Brüssel bestehen, begründen und in Deutschland mit den Folgen der Umstellung auf härteren Abgastest.
Richtig ist, dass weitere Anzeichen für einen Abschwung sprechen, nicht zuletzt der deutliche Rückgang der Exportnachfrage. Die Eurozone als Ganzes und vor allem natürlich Deutschland sind in hohem Maße abhängig von den Entwicklungen in der Weltwirtschaft. Und hier zeichnet sich überdeutlich eine Abkühlung ab.
China unter Druck – die Schulden wachsen zu schnell
Da ist die nicht mehr zu leugnende Abkühlung in China. Das Reich der Mitte stand für einen Großteil des Weltwirtschaftswachstums seit der Finanzkrise. Aus Angst vor sozialen Verwerfungen hat die chinesische Regierung ab 2009 mit einem gigantischen schuldenfinanzierten Konjunkturprogramm nicht nur die eigene Konjunktur stimuliert, sondern die ganze Welt mitgezogen. Der Preis für diesen Boom ist erheblich. Immer mehr Schulden wurden gemacht, die immer weniger realwirtschaftlichen Effekt hatten: Überkapazitäten, Geisterstädte und Fehlinvestitionen waren die unweigerliche Folge.
Wie immer, wenn die Schulden zu schnell wachsen, ist das nicht nur ein Zeichen für zunehmende Spekulation, sondern ein sicherer Indikator für bevorstehende Probleme in der Realwirtschaft. Allen großen Krisen ging ein derartiges Schuldenwachstum voraus. Das war 1929 in Amerika so. Das war 1990 in Japan der Fall, und es war auch die Ursache für Finanz- und Eurokrise.
Wie in den anderen Fällen auch, betonen die Optimisten, dass in China „alles anders wäre“. Diese Beschwichtigung ist für sich genommen schon ein Alarmzeichen erster Güte. Natürlich ist das Land autoritär geführt, natürlich ist die Staatsverschuldung noch moderat und der Staat kann das machen, was man als Staat in einem solchen Fall macht: die privaten Schulden übernehmen.
Warum China das Schicksal Japans droht
Doch wie man am Beispiel Japans beobachten kann, ist es damit nicht getan. Schon fast drei Jahrzehnte ist Japan in einer Periode der Dauerstagnation gefangen. Eine wesentliche Ähnlichkeit mit Japan wird dabei von China-Beobachtern gerne vergessen: Auch China steht vor einem deutlichen Rückgang der Erwerbstätigenzahl – Folge der Ein-Kind-Politik.
Warum China das Schicksal Japans droht
Doch wie man am Beispiel Japans beobachten kann, ist es damit nicht getan. Schon fast drei Jahrzehnte ist Japan in einer Periode der Dauerstagnation gefangen. Eine wesentliche Ähnlichkeit mit Japan wird dabei von China-Beobachtern gerne vergessen: Auch China steht vor einem deutlichen Rückgang der Erwerbstätigenzahl – Folge der Ein-Kind-Politik.
Die chinesische Regierung scheint die Gefahr erkannt zu haben und versucht das hemmungslose Kreditwachstum unter Kontrolle zu bekommen und abzubremsen. Dazu gehört das rigorose Vorgehen gegen die Schattenbanken. In die gleiche Richtung geht der Versuch, die Abhängigkeit des Landes von Exporten und Investitionen zu reduzieren und die Konsumnachfrage zu stärken. Eine Umstellung, die leicht klingt, in der Praxis jedoch bei Weitem nicht so leicht zu bewältigen ist. Zu groß die Gefahr, dass die hoch verschuldeten Unternehmen, die zudem auf erheblichen Überkapazitäten sitzen, dadurch noch tiefer in die Krise gestürzt werden.
So oder so ist unstrittig, dass China vor einer Phase geringeren Wachstums steht, was entsprechend negativ auf die Welt ausstrahlt. Der deutliche Rückgang der Autoverkäufe in China, auch abzulesen an den Ankündigungen für Preissenkungen, ist gerade aus deutscher Sicht ein Alarmsignal erster Güte. China war für unsere Exportindustrie nicht nur die größte Stütze in den letzten Jahren, sondern auch der Haupt-Gewinntreiber. Dreht sich dies nun um, schlägt es unweigerlich auf die Konjunktur hierzulande durch.
Trump wittert die Schwäche
Trump wittert die Schwäche
In diese Situation hinein platzt nun der Handelskrieg des Donald Trump, der meines Erachtens nur wenig mit Handel zu tun hat, dafür umso mehr mit strategischen Überlegungen der USA. Was sollten die USA denn ernsthaft gegen ein Handelsdefizit mit China (und uns) haben, wenn sie dieses doch – wie gehabt – mit ihren grünen Papierscheinen, genannt US-Dollar, finanzieren können. Solange die USA die unbestrittene Weltmacht bleiben, bleibt der Dollar die Weltwährung, mit allen damit verbundenen Privilegien – unter anderem dem nicht unwesentlichen Vorrecht, echte Waren mit bunten Zetteln zu bezahlen, deren Wert man beliebig und nach eigenem Ermessen beeinflussen kann.
Es dürfte der US-Regierung also nicht um Handelsdefizite gehen, sondern um die Verteidigung des Status als unbestrittener Weltmacht. Blickt man auf die Entwicklung Chinas, so ist klar, dass es nur eine Frage weniger Jahrzehnte ist, bis das Land alleine aufgrund seiner Bevölkerungszahl und der überdurchschnittlichen Leistungen der Schüler in den für die Zukunft so wichtigen Fächern wie Mathematik zu einem ernsthaften Konkurrenten der USA werden kann. Da bietet es sich aus Sicht der USA an, diesen Zeitpunkt zumindest solange wie möglich aufzuschieben.
Der Zeitpunkt für einen Handelskrieg ist so gesehen klug gewählt. Die USA stehen vordergründig gut da, haben die Finanzkrise hinter sich gelassen und das Banksystem solide aufgestellt. Die Beschäftigungslage ist gut und die US-Notenbank Fed scheint die einzige der großen Notenbanken zu sein, die ernsthaft aus der Politik des billigen Geldes aussteigen kann. Der Zinsanstieg in den USA führt bereits zu Problemen in den hoch in US-Dollar verschuldeten Schwellenländern, schwächt aber auch China, weil es den US-Dollar auch für Chinesen attraktiver macht. Kapitalflucht war schon immer eines der Probleme Chinas.
China ist jedoch anfällig für die Maßnahmen der USA. Schon jetzt gibt es wenige Bereiche, wo das Land ernsthaft Gegenmaßnahmen ergreifen kann, sollten die USA weitere Schritte ergreifen. Gelingt es den USA, China in eine Rezession zu stürzen, dürfte das zumindest kurzfristig die politische Stabilität gefährden und damit die Entwicklung des Landes negativ beeinflussen. Auch wenn dies die Entwicklung Chinas nur bremsen, aber nicht verhindern kann, dürfte es einige Jahre dauern, bis sich China davon erholt.
Die USA wird es auch treffen
Wenig tröstlich ist da, dass die USA keineswegs so gut dastehen, wie es scheint und Donald Trump darstellt. Das billige Geld der Fed hat erhebliche negative Nebenwirkungen. So ist die Verschuldung der US-Unternehmen förmlich explodiert und sogar der Internationale Währungsfonds warnt vor den Folgen dieser Schulden. Die Unternehmen haben das Geld nicht dazu verwendet zu investieren, sondern um eigene Aktien zurückzukaufen und Wettbewerber zu übernehmen.
Symptomatisch mag der Fall von General Electric dienen: Vor zehn Jahren noch mit dem besten Rating AAA versehen, droht die Industrieikone zu Junk zu werden. GE ist nicht alleine: Immerhin Anleihen im Volumen von über 1000 Milliarden US-Dollar könnten in einer Rezession schnell den Investment-Grade verlieren und zu Junkbonds werden. Eine massive Krise wäre die unweigerliche Folge. Seit 2009 ist das Volumen an BBB Bonds in den USA um fast 230 Prozent auf nunmehr 2500 Milliarden US-Dollar angewachsen. Immerhin die Hälfte aller Investment-Grade-Anleihen haben nur noch ein BBB Rating.
Kommt es nun zu einer Rezession in den USA, ist es nur eine Frage wann, und nicht, ob es zu einer neuen Finanzkrise kommt. Zu hoch ist die Verschuldung der Unternehmen, die sich auch in einer anderen Kreditkategorie zeigt: den sogenannten „Leveraged Loans“. Das sind Kredite an Unternehmen, die bereits hoch verschuldet sind, zum Beispiel im Rahmen von Private-Equity-Transaktionen. Die Kreditgeber sind meistens Institutionen, wobei, wie auch in der Finanzkrise vor zehn Jahren, immer mehr dieser Kredite zu Wertpapieren gebündelt und an renditehungrige Investoren verkauft werden. Eine Praxis, die der Internationale Währungsfonds kürzlich als höchst problematisch und riskant einstufte. Besonders bedenklich stimmt, dass die Kreditgeber so sorglos sind, dass sie sich nicht mal um ausreichende Sicherheiten bemühen.
Eine Abschwächung der Weltkonjunktur schlägt so auch auf die USA zurück und hat das Zeug, die dort ebenfalls nur mit billigem Geld unterdrückte, aber nicht ernsthaft überwundene Finanzkrise wieder aufflammen zu lassen. Diese Erkenntnis dürfte auch hinter der zuletzt enttäuschenden Entwicklung der US-Börsen stehen. Hatten diese im Laufe des Jahres noch neue Höchststände erreicht, droht nun ein deutlicher Einbruch. Dass wir uns bereits in einem neuen Bärenmarkt befinden, kann nicht ausgeschlossen werden.
Eurozone als (unbeabsichtigter?) Kollateralschaden
Was zur Eurozone führt. Ich will an dieser Stelle meine vielfach gemachten Aussagen zum Zustand der Währungsunion im Jahre zehn der Eurokrise nicht wiederholen. Kurz gefasst:
- Die Eurozone ist in der jetzigen Form nicht überlebensfähig.
- Die Mitgliedsländer haben sich weiter auseinanderentwickelt, statt sich – wie erhofft – anzunähern.
- Die Schulden und Wettbewerbsunterschiede sind höher als vor zehn Jahren.
- Das Bankensystem ist immer noch insolvent und fördert die Zombifizierung der Wirtschaft.
- Eine Transferunion kann nichts an diesem Zustand ändern, weil die Dimensionen so gigantisch sein müssten, dass sie jeden Staatshaushalt überfordern.
- Es wäre problematisch, wenn die deutschen Steuerzahler, die deutlich ärmer sind als die Bürger der Krisenländer, diese mit ihrem Geld retten.
- Das führt dazu, dass die EZB ihren Weg der Krisenverschleppung bis zum bitteren Ende wird gehen müssen. Monetarisierung der Schulden lauten die Stichworte.
- Letzteres wird von der deutschen Politik – trotz der erheblichen negativen Folgen für unseren Wohlstand – mitgetragen werden, aus Angst, sich erneut in Europa unbeliebt zu machen und in der Hoffnung, dass es doch noch ein Wunder gibt. Doch das wird nicht passieren.
Offen scheitern wird der Euro deshalb an anderem (faktisch gescheitert ist er schon): entweder an den Mitgliedern der „Hanseatischen Union“ unter Führung der Niederlande oder an Italien. Italien ist zur Zeit der prominenteste Kandidat für einen Austritt aus dem Euro, wobei ich nach wie vor davon ausgehe, dass die dortige Regierung Brüssel und Berlin erfolgreich erpresst – wie hier ausführlich erläutert.
Italien, Handelskrieg und Rezession
Die Zeit spielt für das Land und es spricht für die Strategie der Italiener, alles daranzusetzen, den Schaden den Ausländern aufzubürden. Wie gut das funktioniert, ist nicht zuletzt daran zu erkennen, dass anerkannte Ökonomen wie der Chefvolkswirt der Deutschen Bank offen für eine Zinssubventionierung durch die Steuerzahler anderer Länder eintreten, verbunden mit der Bereitschaft, im Zweifel auf Forderungen zu verzichten.
In diese Gemengelage treffen nun Handelskrieg und Rezession. Es ist schon jetzt absehbar, dass eine Verschlechterung der Konjunktur die eurokritischen Kräfte in Europa stärken wird. Vielleicht haben wir Glück, dass der wahre Zustand der Wirtschaft sich noch nicht zu den Europawahlen im Mai zeigt. Bei späteren Wahlen dürfte sich der Frust dann entladen. Eine weitere Amtszeit von Emanuel Macron ist höchst unwahrscheinlich. Doch wer kommt dann?
Weniger Wachstum, steigende Arbeitslosigkeit und stärkerer Wettbewerbsdruck aus China dürften das Projekt der Währungsunion beenden. Vermutlich noch nicht 2019, aber im kommenden Jahr werden weitere Weichen dafür gestellt werden. So gesehen sind der Euro (und die EU?) Kollateralschäden der US-Politik. Die EU ist allerdings nicht unschuldig, hatten unsere Politiker doch zehn Jahre Zeit, die Probleme zu lösen. Statt das zu tun, haben sie sich hinter Mario Draghi versteckt. Allen voran unsere Bundesregierung.
Richtig schmerzhaft dürfte die Entwicklung für uns Deutsche werden. Derzeit sind wir noch damit beschäftigt,
- die eigenen Schlüsselindustrien zu schwächen (Stichwort Fahrverbote);
- eine unausgegorene Energiewende umzusetzen, die nicht nur zu den höchsten Strompreisen Europas führt, sondern auch zur Verfehlung der CO2-Ziele;
- die Konsumausgaben des Staates ins Unermessliche zu steigern (Stichwort: Rente, Sozialleistungen von rund 10.00 Milliarden Euro, demnächst für alle und ohne Kontrolle);
- die Migration in das Sozialsystem zu fördern.
Schon bald werden wir unsanft aus unseren Träumen vom „reichen Land“ erwachen. Die Exporte werden deutlich einbrechen und das trifft uns aufgrund der deutlich höheren Abhängigkeit vom Export als 2008 nochmals härter. Dann werden wir feststellen, dass wir die letzten Jahre nicht vorgesorgt haben:
- Unsere Handelsüberschüsse haben wir – wie schon vor der Finanzkrise Teil 1 im Jahr 2008 – äußerst schlecht angelegt. Damals war es US-Subprime, heute sind es unter anderem zins- und tilgungsfreie Target2-Forderungen gegen Pleitestaaten in der Eurozone. Erhebliche Verluste sind unvermeidbar. Eigentlich sind sie schon eingetreten, wir sehen es nur noch nicht.
- Unsere Infrastruktur ist derweil deutlich schlechter als in anderen Ländern der EU. Kurzfristig benötigen wir 120 Milliarden für das Nötigste. Mittelfristig müssen wir die Ausgaben nachhaltig erhöhen, was mindestens einem Betrag von zusätzlich 750 Milliarden Euro in den kommenden 30 Jahren entspricht. In der Digitalisierung hinken wir weit hinterher. Im vermeintlich „ärmeren“ Spanien haben immerhin 50 Prozent der Haushalte einen Glasfaseranschluss. Bei uns weniger als zwei Prozent. Und dass sich der Wirtschaftsminister der Partei, die seit mehr als 13 Jahren regiert, für das deutsche Handynetz schämt, sagt alles.
- Unser Bildungssystem verschlechtert sich seit Jahren. Gerade bei den so wichtigen Mathematikleistungen werden wir nach hinten durchgereicht. Besonders enttäuschend sind die Leistungen der Kinder mit Migrationshintergrund. Dies hat vor allem etwas mit unserer Art der Migration zu tun.
- Unsere Industrien stammen mit wenigen Ausnahmen noch aus der Kaiserzeit und stehen vor einem möglicherweise existenzbedrohenden Strukturwandel (Automobil).
- Wir stehen vor einem deutlichen Rückgang der Erwerbsbevölkerung, der nicht durch Migration verhindert werden kann. Statt in Automatisierung, Robotik und Digitalisierung die Antwort auf diese Entwicklung zu sehen – wie in Japan – wird es bei uns nur als Bedrohung betrachtet.
Diese Liste der Versäumnisse der letzten Jahre ist sicherlich nicht vollständig. Euro, EZB und Politik führen zur größten Wohlstandsvernichtung hierzulande seit dem letzten Krieg. 2019 dürfe das Jahr werden, wo sich die Geschichte vom reichen Land als Märchen entpuppt.
Dr. Daniel Stelter — www.think-beyondtheobvious.com
→ manager-magazin.de: „2019 kehren die Krisen zurück“, 26. November 2018