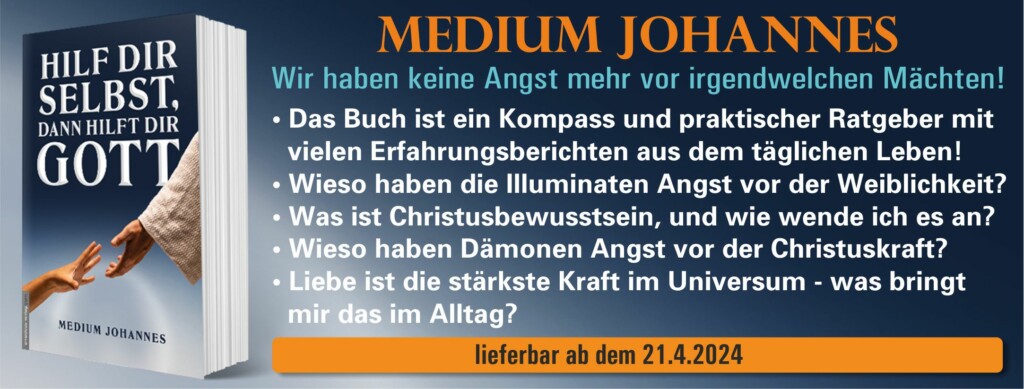Jeder kennt es. Der Abfalleimer oder ‑sack, der als erstes überquillt, ist der gelbe Sack mit dem Verpackungsmüll. Man sieht es und denkt sich leise bei sich: „Ist schon ein Wahnsinn, wieviel Plastik wir in die Gegend pesten.“
 Doch selbst dann, wenn man nur in den Bioladen geht, wo vieles noch in Papp-Packungen angeboten wird, wo man Joghurtgläser und Milchflaschen zurückgeben kann, Käse und Wurst in seine mitgebrachte Frischhaltedose legen lässt und Obst und Gemüse in Packpapiertüten bekommt, wird er zwar wesentlich langsamer voll, aber eben doch voll.
Doch selbst dann, wenn man nur in den Bioladen geht, wo vieles noch in Papp-Packungen angeboten wird, wo man Joghurtgläser und Milchflaschen zurückgeben kann, Käse und Wurst in seine mitgebrachte Frischhaltedose legen lässt und Obst und Gemüse in Packpapiertüten bekommt, wird er zwar wesentlich langsamer voll, aber eben doch voll.
Nun tritt ab 01. Januar 2019 von Staats wegen ein Verpackungsgesetz in Kraft, um des Müllberges Herr zu werden. Und der wird immer schneller immer größer. Mittlerweile ist der Jahresverbrauch pro Kopf bei 220,5 Kilo angekommen. So ein voller, gelber Sack wiegt zirka 2–3 Kilo, je nachdem, wie voll man ihn stopft. Das bedeutet, dass pro Nase pro Jahr etwa 70–80 solcher Säcke anfallen. Das ist schon krass.
Also ist es sicher nicht falsch, etwas an der Verpackungs-Seuche zu machen. Das sind aber nicht nur die Hersteller und Versender schuld, die jetzt einer Registrierpflicht unterliegen und an erster Stelle zur Kasse gebeten werden. Davon bemerkt der Endverbraucher jedoch wenig. Allenfalls der Preis wird steigen, weil die Verkäuferseite die Mehrkosten auf den Endverbraucher umlegen wird. Bei den knallharten Preisverhandlung der großen Supermärkte und Discounter mit den Herstellern ist da wenig Luft im Preis.
Der Grund für das explosionsartige Anwachsen des Verpackungsmülls ist nicht zuletzt ein gesellschaftlicher. Die Anzahl der Single-Haushalte wächst und erfordert kleinere Packungsgrößen. Singles sind zum allergrößten Teil berufstätig und oft nicht gerade in gemütlichen „wir-sind-hier-auf-der-Arbeit-und-nicht-auf-der-Flucht“-Jobs in beschaulichen Verbandsgemeindeämtern. Die meisten Singles arbeiten viel und ehrgeizig, sind immer gut gestylt und haben keine Zeit für tägliches Kochen. Da werden Minigrößen an Aufschnitt, Soja-Chia-Samen Brot in 250 Gramm-Packungen und kleine Fläschchen Fair-Trade-100% naturreine Smoothies gekauft. Obst und Gemüse ebenfalls immer taufrisch und nur wenige Früchte, jedes in einer dünnen Plastiktüte. Dann noch schnell ein paar Bio-Joghurts und Kaffeespezialitäten-Becher für morgens im Auto zum Job und für abends eine Packung mit Slim-Food-fertig-Essen… da ist der tägliche Verpackungsmüllberg beachtlich.
 Wer hat außerdem die Zeit, in die Stadt zu fahren – wenn er das mit dem Diesel überhaupt noch kann – und einen Parkplatz zu suchen, die Geschäfte und Kaufhäuser abzuklappern nach einem Geschenk oder einem Buch, was man gern lesen würde? Die Lösung heißt Online-Versandhandel. Nur: Da fällt ein Mehrfaches der Verpackung an, die nötig wäre, wenn man den Kram im Laden kauft.
Wer hat außerdem die Zeit, in die Stadt zu fahren – wenn er das mit dem Diesel überhaupt noch kann – und einen Parkplatz zu suchen, die Geschäfte und Kaufhäuser abzuklappern nach einem Geschenk oder einem Buch, was man gern lesen würde? Die Lösung heißt Online-Versandhandel. Nur: Da fällt ein Mehrfaches der Verpackung an, die nötig wäre, wenn man den Kram im Laden kauft.
Nun wird der Endverbraucher der Päckchen und Pakete die Kosten des neuen Verpackungsgesetzes nur an einer Preiserhöhung bemerken. Aber andere Veränderungen werden sich auch im Alltag spürbar zeigen:
Ab jetzt gibt es keine Plastikstrohhalme und kein Kunststoff-Party-Besteck mehr. Außerdem werden Einweg-Packungen für sogenannte Obst-Nektar-Getränke und Gemüsenektare sowie Mischgetränke mit Molkeanteilen pfandpflichtig. Das sind 25 Cent pro Packung. Damit die Kunden dazu angehalten werden, lieber Mehrwegpackungen zu kaufen — und damit auch die Hersteller zur Verwendung von Mehrwegpackungen zwingen -, müssen die Supermärkte auch deutlich sichtbare Schilder an den Warenregalen anbringen, die die Mehrweg- und die Einwegverpackungen kennzeichnen. Das gilt aber nur für die pfandpflichtigen Einweg-Getränke-Verpackungen. Der naturreine Apfelsaft bleibt pfandfrei, der Apfelsaftnektar daneben nicht. Alles sehr verwirrend und irgendwie chaotisch. Und wohin bringt man dann die leere, pfandpflichtige Packung?
Darüberhinaus ist es Ziel des neuen Verpackungsgesetzes, die Recyclingquoten zu erhöhen. Das soll schrittweise 2019 und 2022 geschehen. Dabei soll die Recyclingquote von Glas, Altpapier, Eisenmetallen und Aluminium von derzeit 60% auf dann 90% (bis 2022) gesteigert werden. Bei Getränkekartons strebt man eine Quote von derzeit 60% auf 80% an und bei Plastik von derzeit 36% auf 63%.
 Gleichzeitig müssen Recycler wie der „grüne Punkt“ und andere duale Systeme wie interseroh, die sich ja über die Gebühren der Hersteller und Verkäufer finanzieren, besonders umweltfreundliche und leicht verwertbare Verpackungen durch niedrigere Lizenzgebühren fördern. Wie die Verpackungen umweltfreundlicher oder leichter nach Materialien trennbar werden, ist Sache der Hersteller. Auf welche Weise die Hersteller der Verpackungen das gegenüber dem Recycling-Unternehmen belegen müssen oder können, ist nicht zu finden.
Gleichzeitig müssen Recycler wie der „grüne Punkt“ und andere duale Systeme wie interseroh, die sich ja über die Gebühren der Hersteller und Verkäufer finanzieren, besonders umweltfreundliche und leicht verwertbare Verpackungen durch niedrigere Lizenzgebühren fördern. Wie die Verpackungen umweltfreundlicher oder leichter nach Materialien trennbar werden, ist Sache der Hersteller. Auf welche Weise die Hersteller der Verpackungen das gegenüber dem Recycling-Unternehmen belegen müssen oder können, ist nicht zu finden.
Möglicherweise ist das die Zentrale Stelle, die nun eingerichtet wird, um den ganzen Verpackungsmüll zu kontrollieren. Hier registrieren sich auch die „Inverkehrbringer“ der Verpackungen.
“Vorstand dieser Zentralen Stelle ist Gunda Rachut. ‘Aktuell verzeichnet das Register 70.000 Einträge. Bis Januar 2019 erwarten wir eine Verdopplung der Zahlen’, sagt sie. Das Register habe eine hohe Zahl an ‘Trittbrettfahrern’ aufgedeckt, die bisher keine Gebühren bezahlt haben. Damit sei ein wichtiges Ziel schon erreicht, bevor das Gesetz überhaupt in Kraft trete. Viele hätten das Register aber auch noch nicht genutzt, für die sei es ‘quasi fünf vor zwölf’.”
Sich drücken kann nämlich teuer werden. Bis zu 200.000 Euro Bußgeld drohen, wenn man sich nicht korrekt lizensiert. Die Recycler bieten Beratung an und rechtssichere Lizenzierung. Bei dem Recycler Landbell kostet dieser Service 75 Euro/Jahr, bei Lizenzero geht das ab 49 Euronen. Natürlich kommen die Lizenzgebühren für die zu ermittelnde Menge an Verpackungsmaterial dazu. Es gibt aber eine Schwelle an Verpackungsmaterial-Menge, unter der für Kleinstverbraucher keine Lizenzgebühren anfallen, melden und registrieren muss man aber. Unterhalb bestimmter Mengen ist auch die Vollständigkeitserklärung nicht nötig.
Ohne Gebühren berät die jeweils zuständige IHK und bietet meistens auch Kurse an, in denen man sich informieren und Fragen stellen kann.