Die Finanz- und Wirtschaftskrise kommt! Im Jahr 2020 schlägt sie zu! Dann kommt die Rezession, und alle Unternehmen gehen Pleite! Dass Verkünder solcher Krisenprognosen große Aufmerksamkeit erzielen, ist verständlich. Denn sie sprechen so gut wie alle und jeden an: Den Sparer, der sein Geld auf dem Bankkonto liegen hat; den Unternehmer, der über seine Investitionspläne nachsinnt; den Investor, der überlegt, wem er sein Geld leiht. Sie und viele andere mehr wären von einer Finanz- und Wirtschaftskrise unmittelbar betroffen.
(von Thorsten Polleit)
Was ist von solchen Krisenprognosen zu halten? Um eine Antwort zu finden, sollte man sich zu allererst mit der Möglichkeit auseinandersetzen, ob volkswirtschaftliche Geschehnisse – also menschliches Handeln – überhaupt mit wissenschaftlichen Mitteln prognostiziert werden können. Was weiß man darüber? Wir wissen zunächst einmal zweifelsfrei, dass menschliches Handeln unter Unsicherheit stattfindet. (Was aber nicht heißt, dass alles unsicher ist: Denn wenn etwas unsicher ist, muss es logischerweise auch etwas geben, was sicher ist!)
Unsicherheit
Unsicher ist zum Beispiel, wie Menschen künftig handeln: Welche Wertvorstellungen sie annehmen, welche Ziele sie formulieren, wie sie auf bestimmte Geschehnisse reagieren. Nicht selten ist auch unsicher, unter welchen konkreten Bedingungen sie handeln werden. Beispielsweise kennt man nicht schon heute alle Märkte, Produkte und Moden, die es künftig geben wird; man weiß nicht, wie die Aktienmarktinvestoren auf Zinsveränderungen reagieren werden. Wie also geht man mit Handeln unter Unsicherheit um?
 Man kann versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen, aus beobachtetem menschlichem Verhalten. Doch leider: Im Bereich des menschlichen Handelns gibt es keine Verhaltenskonstanten. In der Naturwissenschaft ist es möglich, Gesetzmäßigkeiten wie zum Beispiel „Wenn A um x% steigt, dann steigt B um y%“ aufzuspüren. Das aber ist im Bereich des menschlichen Handelns nicht möglich. Menschen reagieren auf einen bestimmten Impuls nicht stets in der gleichen Art und Weise. Der Grund für diese Einsicht ist ein logischer.
Man kann versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen, aus beobachtetem menschlichem Verhalten. Doch leider: Im Bereich des menschlichen Handelns gibt es keine Verhaltenskonstanten. In der Naturwissenschaft ist es möglich, Gesetzmäßigkeiten wie zum Beispiel „Wenn A um x% steigt, dann steigt B um y%“ aufzuspüren. Das aber ist im Bereich des menschlichen Handelns nicht möglich. Menschen reagieren auf einen bestimmten Impuls nicht stets in der gleichen Art und Weise. Der Grund für diese Einsicht ist ein logischer.
Wir wissen, dass menschliches Handeln von Ideen (oder auch: Theorien oder Wissen) bestimmt ist, und dass die Ideen die endgültigen Daten für das Handeln sind; sie sind das ultimativ Gegebene, das sich nicht mehr auf andere Daten (Faktoren) zurückführen lässt.[1] (Genau diese Einsicht begründet übrigens den methodologischen Dualismus: die Einsicht, dass die wissenschaftliche Methode zur Erkenntnisgewinnung in der Wirtschaftswissenschaft eine andere sein muss als die, die in der Naturwissenschaft angewendet wird.)
Und nicht zuletzt wissen wir, dass Menschen lernfähig sind.[2] Lernfähigkeit lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen: (1) Wer argumentiert, der Mensch sei nicht lernfähig, geht davon aus, dass andere den Inhalt seines Gesagten noch nicht wissen, dass sie also lernfähig sind (sonst würde er es nicht sagen). Er begeht damit einen performativen Widerspruch. (2) Wenn jemand sagt „Der Mensch kann lernen, nicht zu lernen“, so setzt er voraus, dass er irgendwann einmal gelernt hat, dass man nicht lernen kann – und attestiert damit Lernfähigkeit. Er begeht also einen offenen Widerspruch.
Lernfähigkeit bedeutet, dass man nicht heute schon alle künftigen Ideen (Wissensbestände) kennen kann, die das künftige Handeln bestimmen; denn sonst wüsste man schon heute, wie künftig gehandelt wird. Zudem impliziert sie, dass man das Handeln nicht (im Sinne von Ursache-Wirkung) als Folge äußerer Faktoren (physikalischer, chemischer oder biologischer Art) erklären kann. Ansonsten könnte man schon heute wissen, wie künftig gehandelt wird, und das hieße, dass der Mensch nicht lernfähig ist – was logisch widersprüchlich wäre.
Damit sollte ersichtlich geworden sein, dass man mit vergangenen Beobachtungen menschlichen Handelns nicht in der Lage ist, künftige menschliche Handlungen auf sachlogisch überzeugende Weise vorherzusagen: Vom Handeln gestern gibt es keine logische Brücke zum Handeln morgen. Wie sind Prognosen für Finanz- und Wirtschaftskrisen vor diesem Hintergrund zu betrachten? Versuchen wir, eine Antwort auf diese drängende Frage zu finden.
Krisenprognosen
Es gibt gute Gründe, das weltweit vorzufindende ungedeckte Papiergeldsystem als instabil einzustufen. Das lässt sich mit der monetären Krisentheorie der Österreichischen Schule erklären: Die Ausgabe von neuem Geld durch Bankkredite, die nicht durch „echte Ersparnis“ gedeckt sind, sorgt für Wirtschaftsstörungen. Sie setzt zunächst einen „Boom“ in Gang, der aber auf Sand gebaut ist. Früher oder später schlägt er in einen „Bust“ um. Und je länger ein Boom angedauert hat, umso stärker wird auch der nachfolgende Bust ausfallen.
Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Bedingungen in der realen Welt, die Boom und Bust beeinflussen. So können im Boom produktive Produkt- und Prozessinnovationen entstehen, die die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft erhöhen und ihre Schuldentragfähigkeit verbessern. Auf diese Weise kann der Boom länger dauern, als die „reine Theorie“ es erwarten ließe. Es kann auch sein, dass der Staat und seine Zentralbank die Marktkräfte aushebeln und so verhindern, dass der Boom in einen Bust umschlagen kann.
Weil sich all das aber nicht exakt vorhersagen lässt (wie man es in den Naturwissenschaften gewohnt ist), ist der Anleger gut beraten, solchen Prognosen, es werde zu einem Crash, einer „Mega-Krise“ zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt kommen (im Jahr 2020, 2021 oder 2022), kritisch gegenüberzustehen. Die in Aussicht gestellten Szenarien sind zwar nicht völlig aus der Luft gegriffen, sie sind aber in Bezug auf Erscheinungsform und zeitlichem Ablauf halt nicht mehr als Mutmaßungen.
Für den unbedarften Anleger, der seine Investitionsentscheidungen von Krisenprognosen abhängig macht, kann das unter Umständen äußerst kostspielig werden. Beispielsweise dann, wenn der Zeitpunkt des Systemzusammenbruchs zu früh an die Wand gemalt wird und den Anleger zum Beispiel dazu verleitet, voreilig aus dem Aktienmarkt auszusteigen. Er kann dann große Verluste in Form von entgangenen Renditen erleiden, die er selbst dann nicht mehr wettmachen kann, wenn die „Krise“ irgendwann dann tatsächlich eintritt.
Wann kommt die Krise?
Vielen ist gar nicht klar, was mit „Krise“ oder „Mega-Krise“ gemeint ist. Unterschiedliche Menschen deuten diese Worte unterschiedlich. Für die einen ist Krise hohe Inflation oder Hyperinflation. Andere wiederum setzen Krise mit Deflation gleich: fallende Preise, tiefe Rezession, Firmenpleiten, hohe Arbeitslosigkeit. Wieder andere meine, eine Mega-Krise zeigt sich erst in Deflation, auf die dann Inflation folgt. Die Krise kann aber auch – und genau das scheint häufig übersehen zu werden – in einem ganz anderen Gewand daherkommen
Und zwar in diesem Gewand: Die Staaten und ihre Zentralbanken legen die letzten Reste des Systems der freien Märkte lahm und verhindern auf diese Weise, dass der Boom, für den das Fiat-Geldsystem sorgt, durch einen Bust beendet und seine Fehler korrigiert werden können. Dass die Politik in diese Richtung arbeitet, dass zeigen viele Indizien. So haben die Zentralbanken die Zinsen auf extreme niedrige Niveaus gedrückt, und sie setzen ihre ganze Macht ein, um zu verhindern, dass die „Blasenwirtschaft“ platzt.
Die disruptive Krise kann unter diesen Bedingungen bis auf Weiteres ausbleiben. Doch etwas anderes, nicht weniger dramatisches geschieht: Indem Staat und Zentralbank ihre Eingriffe in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben immer weiter ausweiten (durch Ge- und Verbote, Gesetze, Regulierungen und Besteuerung), schmelzen die bürgerlichen und unternehmerischen Freiheiten dahin, und die Quelle des künftigen Wohlstands versiegt. Eine Lenkungs- und Befehlswirtschaft entsteht: Staat und Zentralbank bestimmen, wer was wann wo produziert und wer was wo und wann konsumiert.
Das Bankenproblem
Solch ein Szenario erscheint durchaus plausibel im Euroraum, wenn man sich vergegenwärtigt, wie mit dem Euro-Bankenproblem umgegangen wird. Zweifelsohne sind die Banken eine besonders kritische Variable im ungedeckten Papiergeldsystem. Sie produzieren den Großteil des ausstehenden Kredit- und Geldmengenvolumens. Und in ihren Bilanzen sind die Ersparnisse von Millionen von Menschen ausgewiesen – in Form von Eigenkapital, Depositen und Schuldpapieren. Es ist keineswegs übertrieben zu sagen, dass das Wohl und Wehe des Fiat-Geldsystems in entscheidendem Maße von den Banken abhängt.
Im Euroraum hat das Eigenkapital vieler Banken noch einen großen Abschreibungsbedarf zu verkraften. Das ist durchaus heikel, schließlich operieren die Kreditinstitute traditionell mit einer sehr geringen Eigenkapitaldecke, die durch Kreditausfälle rasch aufgezehrt werden kann. Zudem sehen sich die Geldhäuser wachsenden Ertrags- und Gewinnproblemen gegenüber. Die Frage, die man sich an dieser Stelle stellen muss, lautet: Wird es der Euro-Bankensektor sein, der in die Knie geht, und wird sein betriebswirtschaftliches Scheitern die nächste Euro-Krise (oder Schwereres) auslösen?
Wer diese Frage bejaht, der macht wohlmöglich die Rechnung ohne den Wirt. Denn was würden die Staaten und die Europäische Zentralbank (EZB) in solch einer „Notsituation“, in der Banken drohen Pleite zu gehen, machen? Die EZB ist der Monopolist der Euro-Geldproduktion. Sie kann den Banken jede gewünschte Kredit- und Geldmenge verabreichen. Auf diese Weise schafft sie das Liquiditätsrisiko effektiv aus der Welt. Zudem kann sie auch noch dafür sorgen, dass die Euro-Banken bei Bedarf mit neuem Eigenkapital ausgestattet werden, wenn das Insolvenzrisiko schlagend wird.
Die EZB kann folgendes machen: Die Euro-Staaten werden aufgefordert, neue Schuldpapiere auszugeben, die dann von der EZB gekauft werden. Die dadurch neu geschaffenen Euro zahlen die Staaten als Eigenkapital in die Banken ein. Die Euro-Banken werden – je nach Ausmaß der Rekapitalisierung – de facto verstaatlicht. Die Altaktionäre der Banken erleiden zwar hohe Verluste, aber die Banken bleiben über Wasser. Die Zahlungsfähigkeit des Euro-Fiat-Geldsystems bleibt erhalten. Zahlungsausfälle auf den Kreditmärkten sind abgewendet, das staatlich subventionierte Bankensystem bricht nicht plötzlich zusammen.
Die letzten Jahre der „Rettungspolitiken“ im Euroraum haben deutlich gemacht, dass ein Systemkollaps durchaus lange Zeit verhindert werden kann. Und solange die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sind, solange die Zentralbanken noch immer neue Kaninchen aus dem Zylinder zaubern können, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der „Mega-Crash“ auf sich warten lässt. Die Anleger haben dann allerdings mit den Begleiterscheinungen zu kämpfen: Null- und Negativzinsen, Entwertung des Geldes durch Inflation, Einstellen der Zahlungsverpflichtungen von Staaten und Banken, steigende Besteuerung, Bargeldverbot.
Was zu lernen ist
Wann genau die Krise oder der Mega-Crash kommen, und welche Gestalt sie annehmen – das sind Fragen, auf die die Wirtschaftswissenschaft letztlich keine Antwort geben kann. Sie kann bestenfalls bedingte Prognosen machen – Prognosen, die das Vorliegen von (einigen, aber nicht allen) künftigen Bedingungen, unter denen gehandelt wird, bereits heute schon als bekannt voraussetzen. Doch ob damit eine Prognosegüte erreicht wird, die Gehaltvolles über das künftige menschliche Handeln sagen kann, darf ernstlich bezweifelt werden.
 Die Unterstützung, die die Ökonomik zur Erhellung des Zukünftigen geben kann, ist also recht gering. Wenn es etwas gibt, was der Ökonomik als prognostische Fähigkeit ausgelegt werden kann, sind das „nur“ ihre apriorischen Aussagen, die a priori Handlungskategorien und die daraus abgeleiteten Theorien und Theoreme. Doch sie sind nur insoweit für Prognosen nützlich, als dass man Kenntnis über die künftigen Bedingungen hat, unter denen das Handeln tatsächlich stattfindet – die aber ist in der Regel eben nicht vorhanden.
Die Unterstützung, die die Ökonomik zur Erhellung des Zukünftigen geben kann, ist also recht gering. Wenn es etwas gibt, was der Ökonomik als prognostische Fähigkeit ausgelegt werden kann, sind das „nur“ ihre apriorischen Aussagen, die a priori Handlungskategorien und die daraus abgeleiteten Theorien und Theoreme. Doch sie sind nur insoweit für Prognosen nützlich, als dass man Kenntnis über die künftigen Bedingungen hat, unter denen das Handeln tatsächlich stattfindet – die aber ist in der Regel eben nicht vorhanden.
Das heißt nun nicht, dass es niemanden geben kann, der Ihnen, verehrte Leserin, geehrter Leser, die „richtige“ Krisenprognose stellen könnte. Es ist durchaus möglich, dass es Personen gibt, die heute schon wissen, wann und wie sich die Krise des ungedeckten Papiergeldes entfaltet. Eines ist allerdings sicher: Zu diesen Personen gehören nicht die Hauptstrom-Ökonomen, die die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft begreifen und mit aufwendigen Modellen, die auf Vergangenheitsdaten aufbauen und Verhaltenskonstanten aufzuspüren gedenken, die Zukunft prognostizieren.
Viele Menschen haben ein großes Bedürfnis, über Zeitpunkt und Form der Krise rechtzeitig informiert zu sein. Doch im Grunde ist viel wichtiger, wie man als Privatinvestor oder Unternehmer in einer Weise investiert, dass der Investitionserfolg nicht davon abhängt, dass man den Zeitpunkt der Krise genau vorausgesehen hat (was, wie wir gesehen haben, für die meisten ohnehin unmöglich sein dürfte), sondern dass er möglichst unabhängig davon wird. Wie das geht, lässt sich bei nachweislich erfolgreichen Investoren nachschlagen.
Wer zum Beispiel studiert, wie Benjamin Graham, Phil Fisher, Warren F. Buffett, Charlie Munger, Joel Greenblatt und andere Investoren mit Unsicherheit umgehen, der wird nicht nur rasch merken, dass Krisenprognosen ihren Schrecken verlieren. Er wird auch erkennen, was wirklich wichtig, weniger wichtig und unwichtig ist beim Umgang mit Unsicherheit und Finanz- und Wirtschaftskrisen. Sich Gedanken machen über den Zeitpunkt des Crashs gehört jedenfalls bei diesen Investoren nicht dazu.
[1] Hierzu Mises (1957), Theory and History. An Interpretation of Social and Economic Evolution, Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama, S. 1 – 4.
[2] Zu diesem Argument siehe Hoppe, H. H. (1983), Kritik der kausalwissenschaftlichen Sozialforschung. Untersuchungen zur Grundlegung von Soziologie und Ökonomie, Studien zur Sozialwissenschaft, Westdeutscher Verlag, Opladen, z. B. S. 44 – 49.
Thorsten Polleit, Jahrgang 1967, ist seit April 2012 Chefvolkswirt der Degussa. Er ist Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth, Adjunct Scholar am Ludwig von Mises Institute, Auburn, US Alabama, Mitglied im Forschungsnetzwerk „Research On money In The Economy“ (ROME) und Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Er ist Gründungspartner und volkswirtschaftlicher Berater eines Alternative Investment Funds (AIF). Die private Website von Thorsten Polleit ist: www.thorsten-polleit.com. Hier Thorsten Polleit auf Twitter folgen.
Quelle: misesde.org

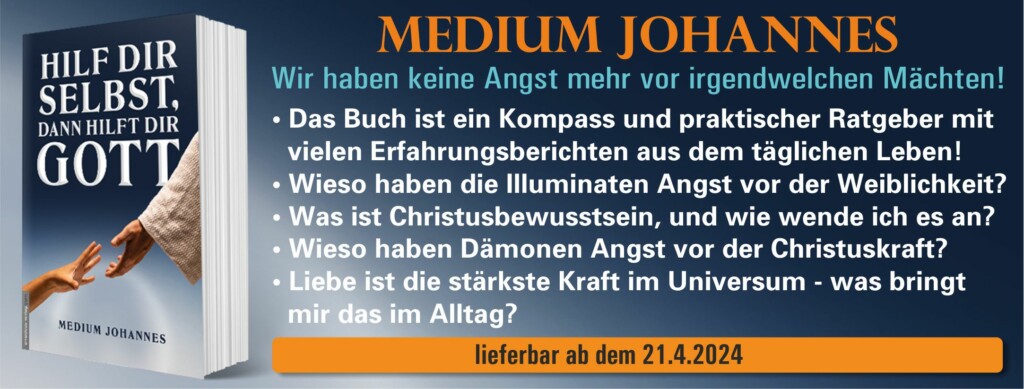




























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.