Nichts kennzeichnet das Scheitern der Entwicklungshilfe besser als die nackten Zahlen. Als die afrikanischen Länder um 1960 unabhängig wurden, betrug der Anteil Afrikas am Welthandel etwa 5,5 Prozent. Heute sind es nur noch 5 Prozent und das trotz Vervierfachung der Bevölkerung. Während dieses Zeitraums sind laut Weltbank mehr als tausend Milliarden Dollar an Hilfsgeldern nach Afrika geflossen. Die aus Sambia stammende Ökonomin Dambisa Moyo bezeichnet die westliche Entwicklungshilfe daher als Dead Aid und plädiert für ihre Abschaffung.
(von Titus Gebel)

Der geschilderte Sachverhalt bedeutet auch: Wenn Afrika morgen von der Landkarte verschwände, wären die Auswirkung auf die Weltwirtschaft marginal. Bereits damit ist die Behauptung widerlegt, der westliche Wohlstand sei auf Kosten der Afrikaner entstanden. Das ist angesichts der genannten Zahlen denknotwendig ausgeschlossen. Der Rest der Welt braucht Afrika nicht, um Wohlstand zu generieren.
Aber angesichts seiner Größe, Bevölkerungszahl, seines Rohstoffreichtums und auch der Ergiebigkeit der Böden hat Afrika zweifellos erhebliches Potenzial, das ungenutzt brach liegt. Der ehemalige deutsche Botschafter in Kamerun, Volker Seitz, hat mehrfach überzeugend dargelegt, zuletzt hier, dass die bisherige Entwicklungshilfe kontraproduktiv ist, weil sie die Eigeninitiative lähmt, Fehlanreize setzt, eher im Interesse der „Armutsindustrie“ als der Entwicklungsländer liegt und Gelder letztlich in den Taschen kleptokratischer Politiker landen. In der Tat ist das beharrliche Festhalten an dieser gescheiterten Politik sinnlose Verschwendung von Steuergeldern, für das die Verantwortlichen eigentlich vom Souverän zur Rechenschaft gezogen werden müssten.
Was tun? Einerseits kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass die Afrikaner für ihr Schicksal selbst verantwortlich sind und sich daher auch selbst helfen müssen. Das wird angesichts der dortigen Geburtenrate mit hoher Wahrscheinlichkeit allerdings dazu führen, dass der Migrationsdruck nach Europa noch zunehmen wird.
Trade statt Aid
Volker Seitz schlägt stattdessen vor, auf eine stärkere Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft vor Ort zu setzen, anstelle auf planwirtschaftliche Almosenverteilung (in Tichys Einblick 08/2019 Geschäfte mit der Armut). Zweifellos ein lobenswerter Ansatz, aber „mithilfe der Aufstellung von Businessplänen freies Unternehmertum zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen“ wird eher nicht gelingen. Ein Businessplan ist zunächst nichts als beschriebenes Papier. Er kann noch so genial sein, wenn die realen Rahmenbedingungen seine Umsetzung nicht zulassen, werden die gewünschten Ergebnisse nicht eintreten. Und genau das ist das Problem. Ich möchte das einmal anhand von einigen praktischen Erfahrungen schildern, die jeder Unternehmer in Afrika, egal ob Einheimischer oder Ausländer, so oder in ähnlicher Form macht.
- Stellen Sie sich vor, Sie müssten für jedes Produkt, das sie einführen, 16 verschiedene Formulare ausfüllen und dazu zehn verschiedene Behörden aufsuchen. Einige Beamte machen Ihnen klar, dass sie die Bearbeitungszeit nur beschleunigen können, indem sie eine Zusatzgebühr entrichten.
- Falls Sie ein genehmigungspflichtiges Vorhaben, etwa einen Produktionsbetrieb, beginnen wollen, können Sie die erforderlichen Antragsunterlagen nicht einfach per Post in die Hauptstadt schicken. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die Unterlagen dort nie ankommen. Jegliche Korrespondenz muss per Kurier erfolgen.
- Falls sie alle Voraussetzungen für die Genehmigung erfüllen, kommt es vor, dass Ihnen die Genehmigung trotzdem nicht erteilt wird, entweder ohne Angabe von Gründen oder durch Erfindung von weiteren Voraussetzungen, die keine gesetzliche Grundlage haben. Rechtsansprüche sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen, es sei denn, man hat persönliche, gute Kontakte zur Regierung.
- Sie können dagegen klagen, aber entweder wird der Prozess jahrelang verschleppt oder nimmt durch illegale Einflussnahme auf die Richter einen unerwarteten Ausgang. Eine geordnete Streitschlichtung in einem geregelten Verfahren ist nicht möglich, weder im Verhältnis zum Staat noch gegenüber privaten Vertragspartnern oder in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. Kleinere Unternehmen und Gewerbetreibende können sich aber keine teuren Schiedsgerichtsverfahren leisten.
- Sie erhalten auch keinen Betriebskredit zu akzeptablen Konditionen, weil sie keine Sicherheiten bieten können. Denn ob das Grundstück, auf dem sich Ihr Betrieb befindet, tatsächlich Ihnen gehört, ist unklar. Zwar haben Sie es ordnungsgemäß erworben und sind im Register als Eigentümer eingetragen, doch machen mehrere andere Parteien geltend, dass ihnen dasselbe Recht zustünde. Frühere Registerblätter und Einträge sind verschwunden. Der rechtsverbindliche Eigentumserwerb ist massiv erschwert oder hochkomplex. Dadurch kann kein Fremdkapital aufgenommen werden, das dann in den Betrieb investiert werden oder für Neugründungen verwendet werden könnte. Das ist ein elementares Problem vieler Entwicklungsländer; darauf hat insbesondere der peruanische Autor Hernando de Soto („The Mystery of Capital“) wiederholt hingewiesen.
- Einheimische Mitarbeiter raten davon ab, bei Einbrüchen und Gewalttaten die Polizei zu rufen, weil diese selbst ein größeres Problem darstellt als gewöhnliche Kriminelle. Polizisten sind oft schlecht bezahlt und bessern ihr Salär mit Schutzgelderpressungen und anderen Vorteilsannahmen auf. Nicht jedes Unternehmen kann sich aber einen privaten Sicherheitsdienst leisten.
- Sämtliche Verträge mit dem Staat und die Gesetze, die Ihre wirtschaftliche Tätigkeit regeln, sind nach dem nächsten Regierungswechsel obsolet. Eine langfristige Rechtssicherheit und damit Planbarkeit ist nicht gegeben. Daher bleiben Investitionen aus.
Der letztgenannte Punkt kann dadurch überwunden werden, dass insbesondere größere Vorhaben über internationale Investitionsschutzabkommen und Schiedsgerichtsklauseln abgesichert werden. Dieser Weg ist allerdings inländischen Unternehmen versperrt. Dasselbe gilt für die chinesische Variante, bei der klar ausgehandelt wird, unter welchen Bedingungen chinesische Unternehmen im Land tätig sein dürfen. Verstöße dagegen durch den Partnerstaat führen zum Verlust von China als Investitions- und Handelspartner und sind daher selten. Tatsächlich hat das wirtschaftliche Engagement Chinas, trotz klaren Eigeninteresses, in Afrika in wenigen Jahren mehr Entwicklungsfortschritte bewirkt als Jahrzehnte planwirtschaftlicher Entwicklungshilfe zuvor.
Software ist wichtiger als Hardware
 Es gibt aber noch einen dritten Weg. Er lehnt sich an ein Konzept des Wirtschaftsnobelpreisträgers Paul Romer an. Dieser hat erkannt, dass der rechtliche und administrative Rahmen, sozusagen die „Software“, darüber entscheidet, ob eine Gesellschaft wirtschaftlichen Aufschwung und damit Erfolg hat oder nicht. Die richtige „Software“ ist viel wichtiger als die „Hardware“, also die Zurverfügungstellung von Infrastruktur, das Häuserbauen oder Brunnenbohren.
Es gibt aber noch einen dritten Weg. Er lehnt sich an ein Konzept des Wirtschaftsnobelpreisträgers Paul Romer an. Dieser hat erkannt, dass der rechtliche und administrative Rahmen, sozusagen die „Software“, darüber entscheidet, ob eine Gesellschaft wirtschaftlichen Aufschwung und damit Erfolg hat oder nicht. Die richtige „Software“ ist viel wichtiger als die „Hardware“, also die Zurverfügungstellung von Infrastruktur, das Häuserbauen oder Brunnenbohren.
Nun sind die Verhältnisse in vielen Entwicklungsländern derart, dass trotz Vorhandenseins von einigen fähigen Individuen und Unternehmertypen eine großflächige Reform entweder gänzlich ausgeschlossen ist oder ihre Umsetzung vor Ort scheitert. Warum dies so ist, soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Nehmen wir es einfach als gegeben hin. Romer schlägt daher vor, nach dem Vorbild Hongkongs sogenannte Charter Cities einzurichten, die eine autonome Rechtsordnung haben (in Form einer Charta, daher der Name) und insbesondere eigene Verwaltungsbeamte, die diese umsetzen. Nach Romers ursprünglichem Modell entsendet ein Industriestaat diese Beamten und etabliert seine Rechtsordnung. Er nennt dies beispielhaft „Kanada schafft ein neues Hong Kong auf Kuba“. Das Problem dabei ist, dass kein Staat gerne eine Art fremdes Hoheitsgebiet im eigenen Land hat und dies den üblichen Verdächtigen wieder Munition für Neokolonialismus-Vorwürfe liefert.
Die Lösung dieses Problems ist die Etablierung privat verwalteter Sonderzonen nach dem Konzept Freier Privatstädte. Freie Privatstädte sind eine Art Sonderwirtschaftszone plus, teilautonome Gebiete, welche von einem international agierenden Betreiberunternehmen mit dessen Personal nach weltweit bewährten Rechts- und Verwaltungsstandards geführt werden. Für einen Jahresbeitrag gewährleistet die private Betreibergesellschaft als „Staatsdienstleister“ Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum. Dies umfasst eine Basis-Infrastruktur, Polizei, Feuerwehr, Notfallrettung, einen rechtlichen Rahmen sowie eine unabhängige Gerichtsbarkeit, damit Bewohner ihre berechtigten Ansprüche in einem geregelten Verfahren durchsetzen können. Alle Bewohner erhalten von der Betreibergesellschaft einen schriftlichen „Bürgervertrag“, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten abschließend regelt. Dieser umfasst die vom Betreiber zu erbringenden Leistungen und die dafür zu bezahlende überschaubare Gegenleistung, daneben die geltenden Regeln und die unveräußerlichen Rechte der Bewohner. Streitigkeiten über Inhalt und Auslegung des Bürgervertrages erfolgen vor eigenen, unabhängigen Gerichten. Die Teilnahme ist rein freiwillig und kann vom Bewohner jederzeit beendet werden.
Was ist der Vorteil einer privaten Verwaltung? Vor allem, dass die Anreize für den Betreiber grundverschieden von denen politischer Systeme sind. Erstens hat er ein unmittelbares wirtschaftliches Eigeninteresse am Erfolg des Gemeinwesens. Zweitens kann er, wie jeder Vertragsanbieter, für Fehler haftbar gemacht werden, er kann seine Verantwortung nicht verschleiern oder auf Dritte abwälzen und trägt somit ein eigenes wirtschaftliches Risiko. Drittens stellt er sich dem direkten Wettbewerb. Er kann die Kunden nicht zwingen, sein Produkt abzunehmen, sondern muss allein durch die Attraktivität seines Angebots und sein vertragstreues Verhalten Nachfrager finden.
Dieses Grundmodell kann auf Sonderzonen in Afrika übertragen werden, um vor Ort einen verlässlichen rechtlichen Rahmen und Sicherheit zu bieten, der nicht nach dem nächsten Regierungswechsel wieder verschwindet. Derartige Sonderzonen, ob man sie nun als Superwirtschaftszonen, Wohlstandszonen oder sonstwie bezeichnet, schaffen die Möglichkeit, unkompliziert Grundeigentum zu erwerben und Waren ein- und auszuführen sowie rechtssicher Firmen zu gründen und zu betreiben. Das sind genau die Voraussetzungen, welche in diesen Ländern meist fehlen und eine wirtschaftliche Entwicklung behindern. Sonderzonen haben also beste Voraussetzungen dafür, potenziellen Migranten in ihren eigenen Kulturkreisen ein sicheres Leben und ein wirtschaftliches Fortkommen zu sichern. Sie ziehen darüber hinaus Unternehmen aus der Nachbarschaft und aus der ganzen Welt an, die an stabilen Rahmenbedingungen und neuen Märkten interessiert sind, die fraglichen Gegenden aber bisher aufgrund von politischen Risiken gemieden haben.
Völkerrechtlich wären solche Sonderzonen nach wie vor Teil des Gastgeberstaates, stellten technisch aber Sonderverwaltungszonen da, die eigene Regeln, eigene Gerichtsbarkeit und auch eigene Sicherheitskräfte unterhalten. Vergleichbar ist etwa der Status, den Hongkong oder Macau gegenüber China haben. Dieses Regime kann zunächst für eine bestimmte Zeit festgeschrieben werden, die ausreichend lang ist, um Bewohnern und Investoren Sicherheit zu geben, beispielsweise 50 oder 99 Jahre. Im Anschluss daran wird z.B. eine Volksabstimmung über das weitere Schicksal der Zone anberaumt. Letztlich hängt es davon ab, was auf dem Verhandlungswege mit dem Gastgeberstaat erreichbar ist und welche Anreize dieser hat, einem solchen Abkommen zuzustimmen. Staaten können für ein solches Konzept gewonnen werden, wenn sie sich finanzielle, wirtschaftliche oder politische Vorteile davon versprechen (und nur dann). So hat sich um die Stadtstaaten Hongkong, Singapur oder Monaco ein Gürtel von dicht besiedelten und wohlhabenden Gegenden gebildet. Diese neu entstandenen Wohlstandsgebiete gehören aber zu den umliegenden Staaten. Wenn nun in einem vormals strukturschwachen Gebiet derartige Ballungsgebiete entstehen, dann wäre dies auch für den Gastgeberstaat ein gutes Geschäft. Man stelle sich vor, ein neues Hongkong oder Dubai entstünde im Mittelmeerraum! Dies brächte für alle in der Nähe befindlichen Gemeinwesen erhebliche positive Effekte.
Der Aufbau einer Basis-Infrastruktur, von Sicherheitskräften, einer Verwaltung und einer Gerichtsorganisation erfordert einen erheblichen Finanzierungsaufwand. Aufgrund der politischen Komponente des Vorhabens liegt es nahe, dass potenzielle Einwanderungsländer finanzielle Unterstützung leisten, etwa als Kreditgeber für die Betreibergesellschaft. Dies wäre durchaus kein schlechtes Geschäft. Schätzungen zufolge belaufen sich die Kosten der seit 2015 nach Deutschland stattfindenden Massenzuwanderung auf mindestens 30 Milliarden EUR pro Jahr. Davon könnte man gleich mehrere Sonderzonen in den betroffenen Gebieten aufbauen, die sich nach einer Anlaufzeit – im Gegensatz zu reinen Auffanglagern – selber tragen und im Erfolgsfall sogar die Zuwendungen zurückzahlen können.
Die Verwaltungstätigkeit einschließlich der städtischen Dienstleistungen wird vom Betreiber selbst durchgeführt oder an einen einschlägig erfahrenen Generalunternehmer vergeben, der sich wiederum Unterauftragnehmern bedient, welche die einzelnen Sparten (Müllabfuhr, Straßenbau usw.) abdecken. Dies entspricht dem Sandy Springs-Modell, benannt nach der gleichnamigen Stadt nahe Atlanta, USA, die sämtliche öffentlichen Aufgaben privatisiert hat und nach zehn Jahren das Fazit ziehen konnte, dass die Qualität städtischer Leistungen durchweg gestiegen, die Kosten aber je nach Sparte um 10–40% gesunken sind. Auch private Sicherheitsdienstleister sind bereits in Polizeifunktion im Einsatz, wenn es etwa darum geht, Sicherheit und Ordnung in Sonderwirtschaftszonen zu gewährleisten. Der Betreiber der Zone stellt zudem ein Zivilrechtssystem samt Gerichten zur Verfügung. Die Idee ist, ein bewährtes Rechtssystem zu übernehmen, das Investoren Sicherheit bietet und geeignet ist, wirtschaftliche Prosperität zu fördern, etwa das deutsche BGB oder englisches Common Law. Auch für einen derartigen Import fremder Rechtssysteme gibt es bereits funktionierende Präzedenzfälle, wie etwa die Sonderwirtschaftszonen Dubai International Financial Center und Abu Dhabi Global Market beweisen, die beide auf Common Law beruhende Rechtsordnungen einschließlich Gerichten eingeführt haben.
Es ist wichtig, dass solche Sonderzonen auch Anreize für die Ansiedlung höher Gebildeter, Unternehmer und Investoren bieten. Zonen, deren Einwohner ausschließlich oder weit überwiegend aus Analphabeten bestehen, werden keinen Erfolg haben. Von daher muss jede einzelne Zone die Möglichkeit haben, sich ihre Bewohner selbst auszuwählen, um eine gesunde Mischung aus Quantität und Qualität zu erreichen. Floriert die Sonderzone später, werden automatisch weitere Arbeitsplätze für Ungelernte entstehen.
Die Betreibergesellschaft wird sicherlich die ersten Jahre vorfinanzieren müssen. Aber wenn sie einen Deckungsbeitrag auf 100.000 Einwohner berechnet hat und es kommen dann 200.000, macht sie Gewinn, weil Polizei, Justiz und Infrastruktur nicht ebenso verdoppelt werden müssen, um das gleiche Dienstleistungsniveau zu bieten. Will man kein Beitragsmodell, dann können indirekte Steuern erhoben werden, insbesondere Mehrwertsteuern oder maßvolle immobilienbezogene Steuern wie Grunderwerbsteuern oder Grundsteuern. Die Betreibergesellschaft hat idealerweise anfangs das Grundeigentum auf dem Gebiet der Sonderzone erworben. Allein durch die spätere Wertsteigerung von Grund und Boden dürften eine Gewinn- und eine Querfinanzierung anderer Bereiche darstellbar sein. Wird besonders hoher Überschuss erwirtschaftet, können die Beiträge gesenkt werden.
Andere Anreizstruktur
Die private Struktur der Zone vermeidet die Gefahr, dass im Falle eines Wahlsieges der Gewinner eine ihm nahestehende Gruppe begünstigt oder ein Regime installiert, das die Stabilität gefährdet oder Unternehmen und Investoren vertreibt. Dies ist leider kein Einzelfall, wie die Erfahrungswerte insbesondere aus Afrika zeigen. Systembedingt werden politische (oder religiöse) Konflikte in der Sonderzone erst gar nicht geschaffen.
Trotzdem sind die vertraglichen Rechte und die Menschenrechte der Bewohner gewährleistet. Denn sämtliche Maßnahmen der privaten Verwaltung unterliegen den vertraglichen Vereinbarungen und können daher auch vor den Gerichten überprüft werden. Daneben ist denkbar, dass Gastgeberstaat, Schutzmächte und die Bewohner Abgeordnete in eine öffentliche Überwachungskommission entsenden, die Sorge trägt, dass der Betreiber die per Bürgervertrag zugesicherten Rechte auch einhält. Neben der Einhaltung grundlegender Menschenrechte ist wichtig, dass die im Bürgervertrag garantierte Rechtsposition und die entsprechenden Pflichten nicht einseitig zum Nachteil der Bewohner geändert werden.
Wirtschaftliche Entwicklung, Sicherheit und Stabilität gehen insoweit politischer Partizipation vor. Diese kann in einer zweiten Phase eingeführt werden, etwa nach zehn Jahren, wobei die Bewohner dann z.B. den City Manager bzw. Bürgermeister wählen oder im Wege des Referendums Maßnahmen oder Regeländerungen der Verwaltung ablehnen können.
Es ist weiter vorstellbar, dass die Einwohner über die Zuteilung von Anteilen an der Betreiberfirma im Laufe der Zeit selbst deren Miteigentümer werden. Dadurch würde ein Interessengleichlauf erzielt, da die Bewohner dann nicht nur Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht auf den Gesellschafterversammlungen des Zonenbetreibers hätten, sondern auch ein wirtschaftliches Interesse am Prosperieren der Sonderzone. Die Aktienvergabe kann etwa an eine Mindestverweildauer in der Zone gekoppelt werden, an die pünktliche Bezahlung der Beiträge oder ähnliche Kriterien, die Anreize zum Wohlverhalten schaffen.
Aufgrund der garantierten Sicherheit, der Bindung an Recht und Vertrag, der persönlichen und wirtschaftlichen Freiheiten, der Nichtzulassung politischer Konflikte und der Abwesenheit von Korruption spricht alles dafür, dass solche Gemeinwesen wachsen und gedeihen werden. Sie können vielen Menschen eine Perspektive bieten, die sie anderweitig nicht haben.
Erster Praxistest in Honduras

Der mittelamerikanische Staat Honduras ist das erste Land der Welt, das sich auf ein solches Modell einlassen möchte. Es hat dazu eigens die Verfassung geändert und ein einschlägiges Gesetz geschaffen, damit sogenannte Zonen für wirtschaftliche Entwicklungen und Arbeitsplätze (ZEDEs) entstehen können. Diese müssen die Verfassung und internationale Abkommen beachten, die Honduras geschlossen hat, verfügen im Übrigen aber über eigene Gesetzgebungskompetenz, ein eigenes Grundstücks- und Handelsregister, eigene Sicherheitskräfte und sogar eigene Gerichte. Die Initiative dazu ging von honduranischen Politikern und Regierungsjuristen aus, die zu der Erkenntnis gelangt waren, dass das Land, in dem der Begriff Bananenrepublik geboren wurde, aus vielerlei Gründen kaum reformierbar ist. Auch Paul Romer war zeitweilig als Berater involviert.
Das ZEDE-Regime gilt auch bei Aufhebung des entsprechenden Gesetzes für 50 Jahre weiter. Honduras ist zudem Mitglied der Zentralamerikanischen Freihandelszone CAFTA, die ein eigenes Kapitel zum Investorenschutz bei rechtlichen und tatsächlichen Maßnahmen vorsieht, sowie entsprechende Schiedsgerichtsverfahren. Egal wer in Honduras regiert, einen Rauswurf auf der CAFTA kann sich das Land nicht leisten. Ein erfolgreicher Präzedenzfall könnte hingegen einen ähnlichen Effekt haben wie die erste chinesische Sonderzone in Shenzen. Viele weitere folgten, und im Grunde hat sich China über diese Sonderwirtschaftszonen zum wirtschaftlichen Riesen entwickelt.
Das erste ZEDE-Projekt in Honduras ist in diesem Jahr als Public-Private-Partnership-Modell gestartet. Das Management der privaten Betreibergesellschaft ist bunt gemischt. Es stammt aus USA, Guatemala, Deutschland, Brasilien und Honduras. Das Rechtssystem wird ein Common Law System sein mit (pensionierten) Richtern aus Australien und den USA. Die Finanzierung erfolgt bislang ausschließlich über private Investoren. Auch deutsche Firmen haben Interesse an einer Niederlassung signalisiert, eine Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München wurde eingeleitet. Die staatliche US-Entwicklungsbank OPIC hat Unterstützung für ein erstes Vorhaben zugesagt. Die Sonderzone wird auf unbewohntem Territorium errichtet, damit sichergestellt ist, dass ausschließlich Freiwillige teilnehmen, die einen entsprechenden Vertrag erhalten. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Honduraner, ist im Prinzip aber für alle offen. Die offizielle Anwerbung erster Bewohner soll noch in diesem Jahr erfolgen.
Der Berater der Bundeskanzlerin für Afrikafragen, Günter Nooke, hat jüngst vorgeschlagen, den Ansatz von Sonderzonen als „Inseln der guten Regierungsführung“ einmal zu versuchen. Wie nicht anders zu erwarten, stieß das beim Entwicklungshilfe-Establishment auf wenig Gegenliebe. Privat geht gar nicht und es sollen „keine Parallelstrukturen“ aufgebaut werden. Doch nach nunmehr 60 Jahren des Scheiterns sollte man sich eingestehen: Ohne Parallelstrukturen wird es nicht gehen. Einen Versuch ist es allemal wert. Und vielleicht können wir auch für unsere eigenen Systeme etwas daraus lernen.
——————————-
Titus Gebel ist Unternehmer und promovierter Jurist. Er gründete unter anderem die Deutsche Rohstoff AG. Er möchte mit Freien Privatstädten ein völlig neues Produkt auf dem „Markt des Zusammenlebens“ schaffen, das bei Erfolg Ausstrahlungswirkung haben wird. Zusammen mit Partnern arbeitet er derzeit daran, die erste Freie Privatstadt der Welt zu verwirklichen. Im April 2018 ist sein Buch „Freie Privatstädte – mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt“ erschienen.
Quelle: misesde.org

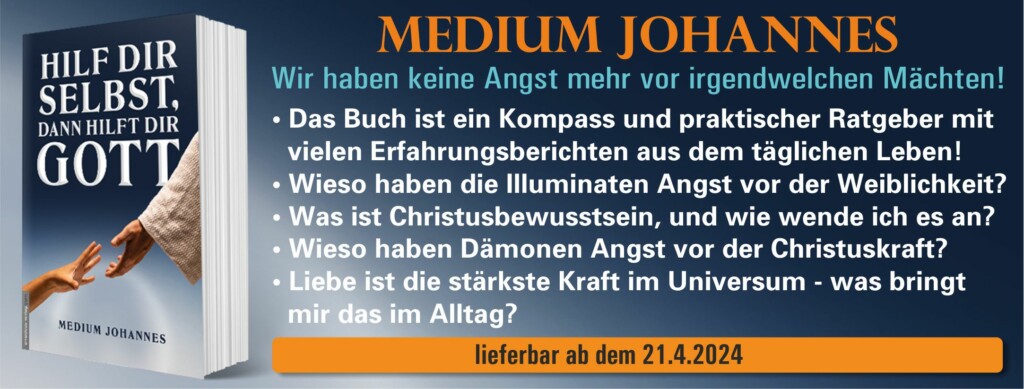




























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.