Es war einmal ein Land, das sich aufmachte, aus der Geschichte zu verschwinden. Nach „drüben“ führte sein Weg und die Reise ging durch das zeitliche Niemandsland des Jahres 1990. Drüben, das war über Jahrzehnte die wechselseitige Betrachtungsrichtung von Ost nach West. Ebenso – nur anders – von West nach Ost. Die einen konnten da lange nicht hin, die anderen wollten lange nicht sehen, was da war. Und doch war das „drüben“ für beide Seiten die Elle, mit der deutsche Politik gemessen wurde. Als man die Ellen 1990 zusammenlegte, stellte man fest, dass beide nicht recht passen wollten für die Zukunft. Aber diese Erkenntnis brauchte ihre Zeit. Cora Stephan fasst in „Im Drüben fischen“ einige ihrer Texte und Essays aus eben dieser Zeit zusammen, als sie, 68’er Westgewächs und gerade der Bonner Redaktion des Spiegel entronnen, mit einer Mischung aus Bewunderung und Verzweiflung – und oft vom beschaulich-verschlafenen Schwerin aus – die Zeitläufte protokollierte.
Ost und West hätten nicht nur grundverschiedene Probleme, sie redeten auch mit Verve aneinander vorbei, so die Autorin. Ein Mangel, der mir als Ostgewächs damals auch aufgefallen war, freilich ohne dies in Worte gefasst oder gar protokolliert zu haben, wie Cora Stephan es tat. Mein Blick reichte damals oft kaum über die kleine Furche hinaus, durch die mich das Leben zog. Nur hin und wieder hob ich verwundert den Kopf, um den Horizont zu suchen. Der freie Blick ist etwas, an das man sich rasch gewöhnen kann, sobald man nicht mehr über die Trümmer stolpert, die der Lawinenabgang 1989 hinterlassen hatte. Ein Berg aus ideologischer Scheiße war zusammengebrochen und es roch nicht gut im Geröll. Bis in die Ferne des Westens, wo man die sanften Abhänge des Berges gern als Vorbild bestaunte, weil man sie nicht riechen musste, drang der modrige Dunst. Wer konnte, wandte sich ab und die Glücksritter des „Pecunia non olet“ hatten freie Bahn.

Man liest heute nicht mehr viele dieser Eindrücke der ersten Stunde, zumal wenn sie sich im Verlauf selbst so häufig korrigieren, das eigene verirrt sein und eine sich verstärkende innere Verzweiflung eingestehen. In Stephans Buch wird nicht der große Pinsel der Welterklärung geschwungen, wie ihn Autoren gern führen, die hinterher vorher immer alles besser gewusst haben. Stattdessen feine Linien. Viele „man könnte doch“, die mitten im Satz unterbrochen werden, weil das Ideal gerade wieder von der Realität überrollt wurde und dem „stattdessen“ Platz machen musste. Waren es im real existierenden Sozialismus die Pläne, die nicht funktionierten, waren es in der Zeit des Übergangs oft die Absichten. Dabei gab es die „Besserwessis“ auch im positiven Wortsinn und ich durfte frühzeitig einige davon kennen lernen. Das Stereotyp des Begriffs allerdings auch, denn unter den Scharen von Verwaltungs- und rechtskundigen Entwicklungshelfern, die in Schwärmen gen Osten geflogen kamen, waren auch merkwürdige bis jämmerliche Gestalten. Trump hätte es wohl so formuliert: „They do not send their very best“.
Ich merke beim Lesen, wie vieles wieder an die Oberfläche drängt aus jener Übergangszeit. Besonders erinnere ich mich an die Herablassung, mit der die „Zonis“ nach der Anfangseuphorie betrachtet wurden, wenn sie sich, statt um ihre „sozialistischen Errungenschaften“ zu sorgen, nach Ansicht vieler Besserlinken im Westen in den schnöden Konsum stürzten. Es war das Quaken der Frösche, die nicht verstanden, warum die Dromedare der Wüste feuchte Augen bekamen, wenn sie plötzlich mitten im See standen.
Die Blicke der Frösche ärgerten mich und ich weiß noch, dass ich versuchte, ihnen mit ostentativem Eskapismus zu begegnen. Natürlich nur im Rahmen meiner sehr bescheidenen Möglichkeiten, wenn ich etwa – anders als die hunderten DDR-Freigänger aus dem ersten offiziellen Zug, der von Magdeburg nach Wolfsburg fuhr – mein Begrüßungsalmosen nicht wie viele andere in Kaffee, Seife oder bei McDonalds umtauschte, sondern mir beim besten Herrenausstatter für die geschenkten 100 Mark ein (für mein damaliges Verständnis) sündteures Hemd kaufte, um dann mit zwar knurrendem Magen aber unverletztem Stolz wieder nach Hause, zurück in die Tristess zu fahren. Das war ja kein blinder, überschwänglicher Konsum! Das hatte Zweck und war folglich etwas ganz anderes und wenn auch das Hemd selbst längst Geschichte ist, ziert es doch bis heute das Foto, das in meinem Führerschein klebt.
Cora Stephan umreißt in ihren Texten, die im Buch ja aus größerer zeitlicher Entfernung sprechen, sehr gut die Mutlosigkeit, die häufig auf den ersten Enthusiasmus folgte. Alles war ja ungeklärt, in erster Linie die Eigentumsfrage. Der ganze Osten Deutschlands hing viel zu lange zwischen gestern und morgen gewissermaßen in der Luft.
„Im Sommer 1990, als die soeben wiederentdeckte DDR für den Westen bereits wieder im Dunst verschwand, weil man von Mailand oder Frankfurt aus Leipzig beim besten Willen nicht erkennen kann, haben auch viele andere Illusionen jene Schwundstufe erreicht, auf der sie durchschaubar werden. Von, sagen wir mal: Schwerin aus gesehen nahm die alte Bundesrepublik phantasmagorische Züge an. Noch einmal blähte sie sich auf zu einer ansehnlichen, gut vierzigjährigen Marktfrau, die ihre ebenso begehrenswerten Waren geschickt zu preisen verstand. Noch einmal versprach sie Handel und Wandel, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, lockte mit Gewaltenteilung, rechtsgebundenen, funktionstüchtigen Verwaltungen und einer überwachen Öffentlichkeit, der kein noch so kleiner Verstoß gegen Recht und Gesetz verborgen bleibe, versprach also sämtliche Schönheiten einer zivilen Gesellschaft und des Lebens in der westlichen Welt — bevor sie in sich zusammensank und als Rumpelstilzchen immer kleinere Kreise zog. »So bleibe doch, du bist so schön«, soll manch einer ihr nachgerufen haben. Ich gestehe: ich auch. Aber wer als Frankfurterin (als Essener, als Westberliner, als Oldenburger) just in Schwerin war, dem erschien sie, trotz allergrößter Gläubigkeit an ihr im Prinzip verträgliches Wesen, immer kleiner und schrumpeliger und unansehnlicher — ja, man hätte wohl in Mailand sein müssen, um ihrer noch in voller Größe gewahr werden zu können. Vielleicht: demnächst wieder.“
Die Beschäftigung mit der DDR, deren Abwicklung und die Auswirkungen der Wiedervereinigung auf den gesellschaftlichen Diskurs hatten, wenn man sie mit Hilfe des Buches betrachtet, etwas angenehm Theoretisches. All die Debatten um historische Einordnung, Schuld und Verantwortung wurden zwar tatsächlich geführt. Jedoch in meiner Wahrnehmung eher auf einer weit entfernten, feuilletonistischen Ebene. All das hatte nichts Drängendes, zumindest wenn man es mit den heutigen Debatten vergleicht. Kaum etwas davon davon wuchs in den Alltag hinein, ja, tangierte ihn kaum mal und wenn doch, dann viel später, nachdem die Erkenntnisse und Ideen durch alle möglichen politischen und Verwaltungsfilter gelaufen waren. Die Realität floss – auch dank fehlendem Internet – langsamer dahin.
Doch das Buch enthält nicht nur Erinnerungen. Es blickt stellenweise geradezu prophetisch ins Heute, schließlich schlägt der Geist der untergegangenen DDR seine Zähne längst wieder in die Gegenwart und aus der überwachen Öffentlichkeit der Anfangsjahre 1989–1991 ist wieder eine überwachte geworden, wie in den Jahren vor der Stunde Null. Wann genau das alles gekippt ist, ist schwer zu sagen, zumal es in Etappen geschah. Neben der Aufarbeitung der Vergangenheit wurde das parteipolitisch eingeträufelte „Schwamm drüber“ über Stasi-Spitzelei immer stärker. Aus den lauen Versuchen, ein Volk von 16 Millionen vor der pauschalen In-Haftnahme als Spitzel zu verteidigen, ist irgendwann der ebenfalls pauschalen Unterstellung gewichen, der Osten hätte in toto ein gewaltiges Demokratie-Defizit, weil die Menschen sich dort ausgegebenen Losungen stärker verweigern als anderswo.
Je weiter die Ereignisse zurückliegen, umso heller überstrahlt das Abstraktum Freiheit die Mühen der Ebene. Und diese Freiheit ist so ziemlich das Beständigste, an dem der Osten nach all den Zusammenbrüchen festhalten konnte. Lange Jahre kristallkugelten Journalisten und Politiker um die Wette, wann sie denn nun abgeschlossen sei, diese deutsche Einheit. Alle nur denkbaren Parameter wurden herangezogen. Da war der Mangel an DAX-Konzernen, die ihren Sitz im Osten hatten oder das Rentenniveau. Man könnte auch messen, wann sich das sächsische Abitur dem Bremer Vorbild angleicht oder die Zahl der Gender-Lehrstühle per Capita und Bundesland untersuchen. Ich denke ja, jetzt, wo der Solidaritätszuschlag verschwindet, steht nur noch das Amt des „Ostbeauftragten der Bundesregierung“ im Weg. Die meisten Unterschiede aber werden bleiben und das ist auch gut so. Denn sie entstammen meist nicht der DDR selbst, sondern sind in den Erfahrungen der gesellschaftlichen Gewitter des Umbruchs entstanden.
Stephans ebenfalls im Buch enthaltener Essay „Politik und Moral“, der im Jahr 1994 entstand, liest sich heute wie die treffende Analyse des Auftakts einer ganzen Reihe moralischer Großübungen, mit denen wir uns seit einigen Jahren herumschlagen, ohne jedoch deren Blaupause zu erkennen. Der moralische Appell „deutsche Einheit“ mit seiner pauschal abverlangten Solidarität war nur der Anfang für die vielen moralischen Erpressungen unserer Tage. Angefangen bei der Einführung des Euro über die Rettung des Euro und die Rettung der Welt durch Demokratieexport bis zu Corona, Klima und postkolonialistischen Bußübungen. Politische Beteiligung wurde zum schlichten und pauschal verlangten Einverständnis umgeformt. Somit wurde schon 1990 der Grundstein für die politische Rhetorik gelegt, die heute Moral in Legitimität verwandelt. Hierzu zum Schluss noch einmal Cora Stephan aus 1994:
„Der moralische Appell hat überdies den Vorzug, dass er Kritik an den politischen Vorgaben der Bundesregierung im Verlauf des Prozesses der deutschen Einheit im Einzelnen als moralische Verfehlung, als Ausdruck nämlich für Teilungsunwilligkeit abzuwehren erlaubt.“
Kommt einem irgendwie erschreckend aktuell vor, oder? Dass diese moralische Erpressung nicht überall im Land gleichermaßen gut funktioniert, ist eine Ungleichheit, die sich hoffentlich nie beheben lassen wird. Denn wo der eine Moral am Werk sieht, erkennt der andere die Forderung nach Linientreue und reagiert verstimmt. In dieser Funktion, so konstatiert Cora Stephan, können sich die „Wessis“ auf ihre „Ossis“ mittlerweile verlassen.
Dringende Leseempfehlung für: Cora Stephan, „Im Drüben fischen“ – Nachrichten von West nach Ost. Erschienen bei edition buchhaus loschwitz, www.kulturhaus-loschwitz.de
Quelle: unbesorgt.de

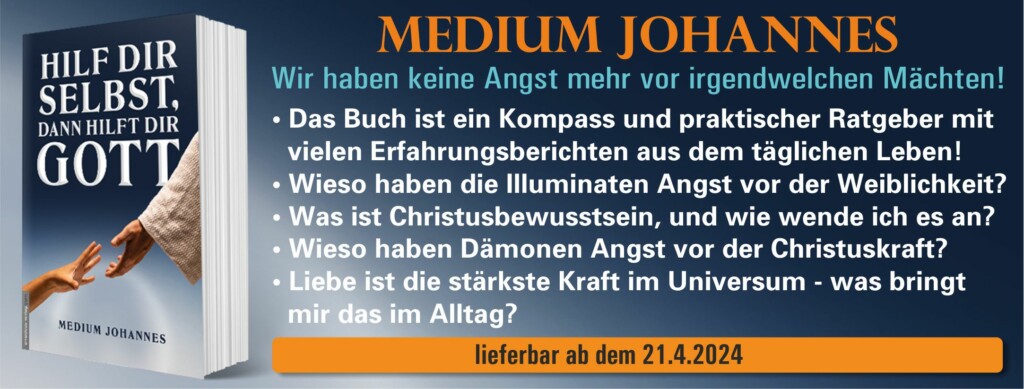




























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.