von Maria Schneider
Heute war ich wieder mal in Frankfurt und man glaubt es kaum – jedesmal, wenn ich aus dem Zug aussteige, durch die Halle gehe und auf den Bahnhofsvorplatz trete, ist die Situation schlimmer, das Menschengedränge dichter, die Verwahrlosung deutlicher, die Kopftücher und Jungmannrotten zahlreicher, die Kakofonie an ausländischem Geschrei lauter, die Tristesse grauer und der Anteil an eingeborenen Deutschen geringer.
Alles beginnt schon damit, dass mittlerweile fast alle Ladengeschäfte in der Bahnhofshalle von Eritreern und Äthiopiern betrieben werden. Will ich radebrechend etwas bestellen und mich drei Mal erklären müssen? Nein. Ich habe meine Thermoskanne dabei.
 Vor ein paar Monaten allerdings hatte ich nach einem langen Arbeitstag so großen Hunger, dass ich beim Asiaten in der Bahnhofshalle etwas bestellte. Nie wieder! Das Besteck war klebrig, auf dem Tisch lagen Essensreste. Der Boden strotzte vor Dreck, der notdürftig von einem Afrikaner in zerlumpter Kleidung zusammengekehrt und dann hinter eine Tür mitten im Essbereich verfrachtet wurde. Mir wurde schlecht und ich stocherte mißmutig in meinem Gericht herum, bis ich den schlimmsten Hunger gestillt hatte.
Vor ein paar Monaten allerdings hatte ich nach einem langen Arbeitstag so großen Hunger, dass ich beim Asiaten in der Bahnhofshalle etwas bestellte. Nie wieder! Das Besteck war klebrig, auf dem Tisch lagen Essensreste. Der Boden strotzte vor Dreck, der notdürftig von einem Afrikaner in zerlumpter Kleidung zusammengekehrt und dann hinter eine Tür mitten im Essbereich verfrachtet wurde. Mir wurde schlecht und ich stocherte mißmutig in meinem Gericht herum, bis ich den schlimmsten Hunger gestillt hatte.
Polizisten verwalten das Elend
Heute morgen um 10 Uhr ist die Halle – wie immer – übervoll mit bekopftuchten Frauen, die ihre Säuglinge in Kinderwagen umherschieben. Warum sie sich ständig in der Halle aufhalten, erschließt sich mir nicht, denn einen Zug nutzen sie nicht. Ich dränge mich durch die Massen an fremdländischen Geräuschen und Gerüchen nach draußen auf den Vorplatz, wo die Dauerbaustelle inzwischen unter einem weißen Zelt untergebracht ist. Auf Anhieb kann ich 6 Polizisten in schwerer Montur und mehrere Sicherheitsleute in gelben Westen identifizieren. Das war vor 2015 nicht so. Persönlich meine ich, dass sie dafür da sind, das Elend zu verwalten und nicht, um uns zu schützen. Wenn überhaupt jemand geschützt werden soll, dann die Migranten vor wütenden Restdeutschen, die möglicherweise ob der massiven Überfremdung ausrasten und die Migranten angreifen könnten. Ich bin sicher, dass die Polizisten in einem solchen Fall erbarmungsloser denn je zuvor durchgreifen würden.
Die Polizei und ihre sich verändernde Rolle vom „Freund und Helfer“ zum Vollstrecker der Regierungsvorgaben erinnert mich an das Jahr 2015, kurz nachdem die Massenmigration begann. An meinem Heimatbahnhof hatten sich seit Wochen Sinti und Roma im Spalier aufgestellt, so dass man ihren penetranten Forderungen, irgendeine Zeitung zu kaufen, die sie direkt ins Gesicht hielten, nicht entgehen konnte. Also rief ich die Polizei an und forderte sie auf, den Störern einen Platzverweis zu erteilen. Damals war die Zensur noch nicht so engmaschig und offensichtlich waren die Weisungen an die Polizei, den Dingen ihren Lauf zu lassen, erst vor kurzem ergangen. Der Polizist druckste eine Weile herum, bis er sagte: „Wir dürfen nichts machen.“ Ich fragte: „Wollen Sie mir damit sagen, dass Sie Weisung haben, nichts zu tun?“ Die überraschend ehrliche Antwort war ein verschämtes „Ja“. Von da an wußte ich, dass wir ganz allein auf uns gestellt sein würden.
Witz des Tages: Eine Waffenverbotszone

Stefan im Rollstuhl mit einem Bein wurde unter den “Augen” der Sicherheitskameras mit 7 Messerstichen erstochen.
(Bauzaun vor der Kaiserstraße, Frankfurt) Foto: Maria Schneider
Neun Jahre später gehe ich im Jahr 2024 in Frankfurt zur Straßenbahnhaltestelle und blicke vor der Kaiserstraße auf eine Bauwand, auf die jemand gesprüht hat: „Stefan im Rollstuhl mit nur einem Bein wurde mit 7 Messerstichen sinnlos getötet. WARUM?“ Daneben ein Schild mit einer Information, wegen der sich junge, traumatisierte Männer wahrscheinlich vor Lachen einnässen werden: „Waffenverbotszone von 20:00 – 05:00 Uhr“. Ich meine, selbst ich kann kaum vor Lachen an mich halten, zumal der Mord am im Graffito verewigten, obdachlosen Rollstuhlfahrer eben in genau jener waffenfreien Zone unter einem Strauß an Überwachungskameras verübt worden war.
 Hinein geht es in die Straßenbahn, die überfüllt ist mit People of Colour aus aller Herren Länder, ein paar jüngeren Anzugmännern, die zur Arbeit gehen und etlichen alten, deutschen Männern, die verwahrlost an Bierdosen nuckeln. Sie erinnern mich an die Ureinwohner Amerikas, die ebenfalls dem Alkohol verfielen, während ihnen ihr Land mit der Propagandalüge, dass sie minderwertig seien und daher nichts besseres verdient hätten, als getötet, vergewaltigt und gemessert zu werden, unter dem Hintern weggestohlen wurde.
Hinein geht es in die Straßenbahn, die überfüllt ist mit People of Colour aus aller Herren Länder, ein paar jüngeren Anzugmännern, die zur Arbeit gehen und etlichen alten, deutschen Männern, die verwahrlost an Bierdosen nuckeln. Sie erinnern mich an die Ureinwohner Amerikas, die ebenfalls dem Alkohol verfielen, während ihnen ihr Land mit der Propagandalüge, dass sie minderwertig seien und daher nichts besseres verdient hätten, als getötet, vergewaltigt und gemessert zu werden, unter dem Hintern weggestohlen wurde.
Auf der Fahrt zu meinem Arbeitsort bin ich ununterbrochen verschiedenen arabischen Gesprächen ausgesetzt – natürlich schreiend, denn das Gegenüber am Handy scheint immer schwerhörig zu sein. Durch die Scheiben sehe ich die afrikanischen Drogenhändler, die offen auf der Straße dealen und ausgezehrte, schwarze Drogenabhängige, die an graffitiverschmutzen und vollurinierten Häuserwänden lehnen.
Im Elysium
Leicht betäubt stolpere ich aus der Straßenbahn und beginne meinen Arbeitstag inmitten der Schönen und Reichen. Ich bin eine der höhergestellten weißen Sklavinnen, während das Servicepersonal an den Getränkeständen fast durchgängig aus arabischen und afrikanischen Ländern stammt. Diese Unterscheidung empört mich nicht. Was mich empört, ist die Tatsache, dass all diese Tätigkeit auch von Weißen zu höheren Stundenlöhnen durchgeführt werden könnten. Da die Wirtschaft jedoch unter extremem moralischem Druck die Migration erzwungen hat, um ebensolche Sklaven zu Niedriglöhnen zu beschäftigen, gehen die weißen Deutschen leer aus. Zudem haben sie keinen Anteil am Mehrgewinn der Unternehmen, denen moralischer Druck gänzlich fremd ist. Normale weiße Deutsche müssen darüber hinaus die Folgen der Migration schmerzlich in Form von Wohnungsnot, Messermorden und Vergewaltigungen erdulden, während der Unternehmenschef in seiner gepanzerten Limousine durch die deutschen Lande chauffiert wird und seine Kinder auf eine abgesicherte Privatschule in England gehen, in denen sie den Umgang mit Gewehren und Pistolen zur Selbstverteidigung lernen.
Im Laufe des Tages frage ich einen jungen Mitarbeiter nach Hilfe und stelle fest, dass er mich nicht versteht. Also erkundige ich mich nach seiner Muttersprache. Ukrainisch oder auch russisch. Man könne es aber auch mit englisch versuchen, schlägt er zaghaft vor. Es ist 11 Uhr und meine Schmerzgrenze als Fremde im eigenen Land ist bereits überschritten. Und so legt sich in mir ein Schalter um und ich antworte: „Ich habe für all das keine Nerven mehr“, drehe mich um und lasse ihn stehen. Es ist besser so, denn sonst hätte ich ihn entweder gefragt, warum er hier ist und meine Zeit und mein Geld verschwendet, statt an der Front zu sein. Oder: Wenn er schon verständlicherweise desertiert, warum er nicht den Anstand hatte, sich im Gegensatz zu seinen Landsleuten, zur Abwechslung mal ein anderes Zielland als Deutschland auszusuchen.
Um 17:30 Uhr ist mein Arbeitstag zu Ende. Man mag es kaum glauben, doch die Straßenbahn ist noch voller als am Morgen. Lediglich das arabische Geschrei ist unverändert gleich. Vor dem Bahnhofseingang sind so viele Menschenmassen, Jugendbanden, arabische Clans, Sinti und Roma, dass ich kaum bis in die Halle vordringen kann. Ich höre kein einziges Wort deutsch, dafür habe ich das Gefühl durch einen undurchdringlichen Sumpf von Schweiß, ungewaschener Kleidung und einer Opiumhöhle zu treiben. Wieder einmal wird mir fast übel und ich muss ruhig atmen, um wahlweise nicht in Panik zu geraten oder all die Fremden und deutsche Drogenabhängige, die wie Zombies umhertaumeln und mich anbetteln, schreiend wegzustoßen.

“Am Hauptbahnhof”. Blick in der Kaiserstraße. Foto: Maria Schneider
Die Zahl der Jungmannrotten geht in die Dutzende. Wie junge Springböcke nehmen sie laut krakeelend und wild gestikulierend – Genital voran – den Platz ein. Wo bin ich hier eigentlich? In Syrien, im Irak, in Afghanistan oder in Afrika?
Das Deutschlandticket – steuerfinanzierter Migrantenexpress
Nun steht folgende Entscheidung an: Möchte ich mit dem Deutschlandticket Geld sparen und einen überfüllten, günstigen Regionalexpress oder Interregioexpress inmitten traumatisierter Schutzsuchender samt Faustkampf‑, Messer- oder Onanierrisiko auf mich nehmen oder mir einen ICE gönnen? Angesichts des bis zum Rand gefüllten Bahnsteigs für den RE, an dem ich kaum ein weißes Gesicht sehe, entscheide ich mich für den ICE. Damit ist auch geklärt, für wen das Deutschlandticket eigentlich seit jeher gedacht war: Für die Migranten, damit sie samt Sack und Pack, samt zahlreicher „klimaschädlicher“, unabgetriebener Kinder sowie mehreren Tüten, Koffern und der Oma, die fit und fidel überall dabei ist und keineswegs in einem Altersheim vor sich hin schimmelt, durch Deutschland reisen und ihre weitläufige Verwandtschaft besuchen können.
Ich buche mein teures ICE-Ticket und bin wieder fast unter Deutschen – außer dem Inder, der drei Reihen vor mir ein langes, lautes Gespräch auf Hindi führen muss.
Überall demoralisierte Deutsche und kraftstrotzende Migranten
Es i st klar, dass der Zug verspätet ist und ich meine S‑Bahn verpasse. Es ist klar, dass in der nächsten S‑Bahn ein Araber wieder laut telefoniert und eine junge Frau mit Kopftuch, langem Mantel und schicker Designtasche sich mir gegenübersetzt. Es ist klar, dass in meinem Bahnhof eine Durchsage erfolgt, dass man sich vor „organisierten Bettelgruppen“ in Acht nehmen müsse. Und es ist klar, dass rund die Hälfte meiner exorbitanten Steuern, die ich aus meinem heutigen Honorar zahlen werde, in arabische und afrikanische Länder fließen wird, während der deutsche Rentner noch nicht mal mehr Pfandflaschen sammeln kann, weil ihm inzwischen zu viele Araber, Afrikaner, Sinti und Roma mit professionellem Vierkant zum Öffnen der Mülleimer Konkurrenz machen, statt umständlich mit einem Kleiderbügel zu hantieren.
st klar, dass der Zug verspätet ist und ich meine S‑Bahn verpasse. Es ist klar, dass in der nächsten S‑Bahn ein Araber wieder laut telefoniert und eine junge Frau mit Kopftuch, langem Mantel und schicker Designtasche sich mir gegenübersetzt. Es ist klar, dass in meinem Bahnhof eine Durchsage erfolgt, dass man sich vor „organisierten Bettelgruppen“ in Acht nehmen müsse. Und es ist klar, dass rund die Hälfte meiner exorbitanten Steuern, die ich aus meinem heutigen Honorar zahlen werde, in arabische und afrikanische Länder fließen wird, während der deutsche Rentner noch nicht mal mehr Pfandflaschen sammeln kann, weil ihm inzwischen zu viele Araber, Afrikaner, Sinti und Roma mit professionellem Vierkant zum Öffnen der Mülleimer Konkurrenz machen, statt umständlich mit einem Kleiderbügel zu hantieren.
Es ist also klar, dass ich so umfassend, tiefgehend und durchgehend von der Gesellschaft dieses Landes angewidert bin wie noch nie zuvor in meinem Leben. Denn was jetzt geschieht, habe ich 2015 vorhergesehen und wurde deswegen geächtet, angeschrien, nach allen Regeln der Kunst fertig gemacht und von Arbeitsaufträgen ausgebootet.
Die Stasi, das bist Du
Und so sollte allen klar sein: Was geschah und nach wie vor geschieht, wurde nicht nur von der Regierung, dem Verfassungsschutz, Merkel, der CDU, den Meldestellen oder Faeser verursacht. Nein, jeder, der damals sein Maul gehalten hat. Jeder, der die Migranten euphorisch an Bahnhöfen beklatscht und mit Tränen in den Augen ihre Babys gewickelt hat. Jeder, der ihnen Obdach und Geld geben, die Ämter unter Druck gesetzt und Nachbarn denunziert hat, die gegen die Einwanderung waren. Jeder, der Astrid Lindgrens Lügengeschichten für bare Münze genommen und geglaubt hat, dass die Araber und Afrikaner es kaum erwarten können, sich von ausgemergelten Veganerinnen in Michels, Lasses, Idas und Pippis ummodeln zu lassen, trägt eine Mitschuld.
Wir brauchen keine Stasi, keine Gestapo, keine PIDE oder andere Geheimpolizeien. Die Stasi, das bist Du, Du und Du, wenn Du bereit warst, Deine Nachbarn, Deine Freunde und Deine Kollegen wegen ihrer Meinung anzuschwärzen, weil Du Deinen eigenen Ärger darüber wie ein trotziges Kind abreagieren, sie bestrafen, oder ihre Arbeitsstelle haben wolltest.
Jeder, der aktiv am Rufmord der Gegner der Massenmigration und des Coronaterrors mitgemacht hat. Jeder, der feige zugesehen hat, wie andere existenziell erledigt wurden. Jeder, der Armlängen Abstand empfohlen, Vergewaltigungen bagatellisiert und Messermörder gehätschelt hat. Jeder, der wie ein dummes, fettes Schwein sein Gesicht in den Futtertrog gesteckt und gehofft hat, dass er der Schlachtung entgeht, ist nicht besser als ein Inquisitor zur Zeit der Hexenverfolgung. Daher muss der Gerechtigkeit Genüge getan werden. Zwar sagt der Herr, „Die Rache ist mein“, doch das enthebt uns nicht der Pflicht, den Übeltätern deutlich zu sagen, dass sie Unrecht begangen haben und sie mit ihren Schandtaten zu konfrontieren.
Letztendlich ist auch dieses klar: Der Tag der Abrechnung rückt näher und ich für meinen Teil kann ihn kaum erwarten.
Der Beitrag erschien zuerst bei beischneider.net.

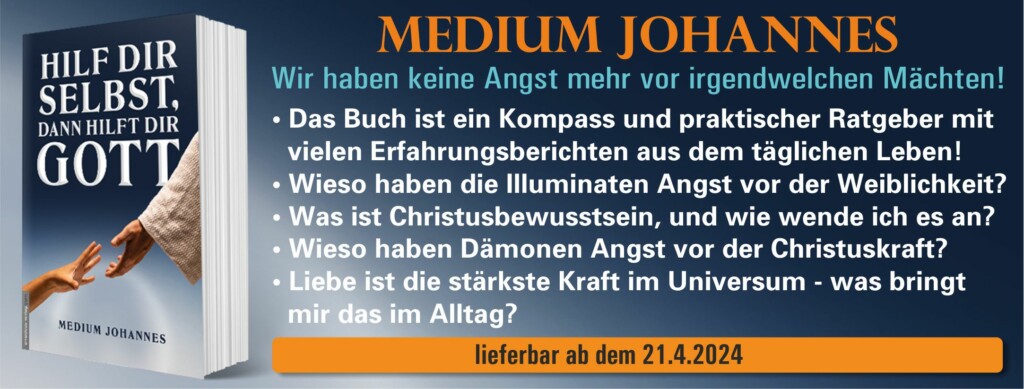




























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.