Trifft die Rezession Deutschland, trifft sie auch Europa. Und damit eine Region, die
- sich bis heute nicht von den Folgen von Finanz- und Eurokrise erholt hat.
- noch immer nicht wahrhaben will, wie sehr der Brexit die Gemeinschaft schwächt.
- bei den zentralen Versprechen der Schaffung von Wohlstand und der Sicherung der Außengrenzen offensichtlich versagt.
- weiterhin die politischen Schwerpunkte falsch setzt.
Die Eurozone, aber auch die EU sind denkbar schlecht auf eine neue Rezession vorbereitet. Die politischen Spannungen werden sich intensivieren und es wird für die EZB zu einer immer größeren Aufgabe, das politische Konstrukt des Euro zu verteidigen. Fällt Deutschland in eine Krise (konjunkturell, aber vor allem strukturell, Stichwort Automobil) und damit als Anker von Euro und EU aus, dürfte es turbulent werden. Hier rächt sich, dass in den letzten zehn Jahren keine ernsthaften Fortschritte gemacht wurden.
Kurze Erinnerung: Warum der Euro nicht funktioniert
 Leser von Stelter wissen, warum der Euro nicht funktioniert. Nach einer Studie der US-Bank JP Morgan haben die Mitgliedsländer der Währungsunion weniger miteinander wirtschaftlich gemein als eine hypothetische Währungsunion aller Länder der Welt, die mit einem „M“ beginnen. Gemessen wird dies an Kriterien wie der Wettbewerbsfähigkeit – vor allem an den Lohnstückkosten, den Löhnen und der Produktivität, dem Gleichlauf der Wirtschaftszyklen und der Frage, ob sich die Mitgleisländer hier annähern, also, ob sie „konvergieren“.
Leser von Stelter wissen, warum der Euro nicht funktioniert. Nach einer Studie der US-Bank JP Morgan haben die Mitgliedsländer der Währungsunion weniger miteinander wirtschaftlich gemein als eine hypothetische Währungsunion aller Länder der Welt, die mit einem „M“ beginnen. Gemessen wird dies an Kriterien wie der Wettbewerbsfähigkeit – vor allem an den Lohnstückkosten, den Löhnen und der Produktivität, dem Gleichlauf der Wirtschaftszyklen und der Frage, ob sich die Mitgleisländer hier annähern, also, ob sie „konvergieren“.
Verschiedene Studien kommen zum gleichen Schluss. Hatten wir ab dem Beschluss der Einführung des Euro tatsächlich eine „Konvergenz“, entwickeln sich die Mitgliedsländer mehr auseinander. Starke Länder – weil relativ produktiver und innovativer – werden immer stärker, schwache schwächer. So der Befund des Internationalen Währungsfonds.[i]
Die Geschichte des Euro ist schnell erzählt. Wer sie genauer nachvollziehen will, kann das hier tun:
→ STELTERS MAILBOX: Wie rette ich mein Geld vor dem Eurocrash?
- Mit der Einführung des Euro begannen die Zinsen in ganz Europa zu sinken – in Richtung des immer schon deutlich tieferen deutschen Niveaus. Dahinter stand die Erwartung, dass der Euro ebenso stabil sein würde wie die D‑Mark, also die Inflationsrate deutlich stabiler und tiefer als zuvor in Spanien, Italien, Frankreich und Portugal. Da die Inflationsraten aber nicht genauso schnell sanken, wie die Zinsen, wurden die Realzinsen – also der Nominalzins abzüglich der Inflationsrate – negativ, was einen starken Anreiz gab sich zu verschulden.
- Während Länder wie Italien die Zinssenkungen dazu nutzen, den Staatshaushalt zu entlasten und so weniger Anpassungsdruck verspürten, kam es in anderen Ländern – vor allem in Portugal, Irland und Spanien – zu einem privaten Verschuldungsboom. Damit einher ging ein Boom im Immobilienmarkt, weil Banken nichts lieber finanzieren als vermeintlich risikoarme Immobilien. Damit kam ein sich selbst verstärkender Boom in Gang. Die Immobilienpreise stiegen, zeigten wie sicher die Spekulation auf weiter steigende Preise war und führten so zu noch mehr kreditfinanzierter Nachfrage. Zugleich begann ein Bauboom, der wiederum die gesamte Wirtschaft stimulierte und die Nachfrage nach Immobilien noch weiter befeuerte.
- Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Blase platzen musste. Auslöser – aber nicht Ursache! – war das Eingeständnis Griechenlands, deutlich höhere Staatsschulden zu haben als zuvor offiziell zugegeben. Die einsetzende Vertrauenskrise in den Euro konnte erst gestoppt werden, als Mario Draghi sein berühmtes Versprechen abgab, „alles Erdenkliche zu tun“, um den Euro zu verteidigen, nicht, ohne zuvor grünes Licht aus Berlin dafür bekommen zu haben. Da niemand erfolgreich gegen eine Notenbank spekulieren, die beliebige Mengen an eigener Währung in die Märkte pumpen kann, endete die Eurokrise damit. Zumindest der sichtbare Teil. In Wahrheit schwelt die Krise weiter und zwingt die EZB zu anhaltender Niedrigzinspolitik.
Seit Beginn der Eurokrise versuchen die Länder, die Folgen der schuldenfinanzierten Party zu bereinigen. Dies bedeutet, die Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen, die Banken finanziell wieder zu gesunden und die faulen Schulden, die sich im Boom angehäuft haben, abzubauen. Dieser Prozess ist schmerzhaft und dauert. Vor allem führt er nicht zu einer weiteren Annäherung, sondern zu Divergenz.
Die Euro-Länder haben immer weniger miteinander gemein. Auf der einen Seite haben wir
- Italien, das bereits auf zwei verlorene Jahrzehnte zurückblickt und im eigenen „japanischen Szenario“ geringen Wachstums feststeckt;
- Spanien, das die Staatsschulden deutlich erhöhte, um so den tiefsten Einbruch zu verhindern;
- Portugal, wo Staat und Private hoch verschuldet sind und das die geringste Innovationskraft aller Euroländer aufweist
- und schließlich Griechenland, das trotz Schuldenschnitt und Hilfe der anderen Euroländer immer noch eine hohe Staatsverschuldung vor sich herschiebt.[ii]
Auf der anderen Seite haben wir Länder wie die Niederlande und Deutschland, die auch dank des Euro an internationaler Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Frankreich hängt dazwischen, nicht so schwach wie die Krisenländer, nicht so stark wie die östlichen Nachbarn.
Wie schon bei der lateinischen Münzunion von 1865 muss man feststellen, dass sich heterogene Staaten mit nationaler Souveränität nicht über ein Geldsystem integrieren lassen. Und wie damals kann man davon ausgehen, dass der Euro noch länger existiert, weil die Mitgliedsländer die Kosten eines Austritts scheuen.[iii]
→ Die Lateinische Münzunion: ein Präzedenzfall für den Euro
Auch heute wären die Kosten eines ungeordneten Zerfalls der Eurozone enorm. Ernsthafte Studien rechnen mit einem Schock für das Weltfinanzsystem und die Weltwirtschaft, der größer wäre als die Finanzkrise. Deutschland wäre in mehrfacher Hinsicht schwer getroffen. Die Exporte würden angesichts einer relativen Aufwertung der Deutschen Mark einbrechen, während zugleich die aufgebauten Forderungen – nicht nur aber auch die TARGET2-Forderungen der Bundesbank – deutlich an Wert verlören.[iv]
Es kann nicht wundern, dass die Politik dieses Szenario scheut. Das Problem ist nur, dass sie nicht handelt, um es zu verhindern. Alle Bemühungen, über gemeinsame Haftung (ESM, Bankenunion) und über mehr Umverteilung (gemeinsame Arbeitslosenversicherung) den Euro zu stabilisieren, müssen scheitern, weil sie nicht das erforderliche Volumen erreichen können, so der IWF[v], und weil sie nichts an den grundlegenden Konstruktionsmängeln des Euro ändern. Damit ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis es zu neuen Spannungen und Krisen kommt. Eine Situation, die nachhaltig nicht funktionieren kann, wird auch nicht auf Dauer funktionieren.
Dabei wird das Problem über Zeit nicht kleiner, sondern größer. Die Schulden bleiben weiterhin auf zu hohem Niveau, die Wirtschaft wächst angesichts stagnierender und bald schrumpfender Erwerbsbevölkerung und geringen Produktivitätsfortschritten immer weniger. Eine Entwicklung, die nicht zum Happy End führen kann, wenn man nicht entschieden und deutlich gegensteuert. Im eigenen Interesse muss Deutschland handeln und eine Sanierung der Eurozone voranbringen.
Kurze Erinnerung: Warum die EU nicht funktioniert
Bevor wir dazu kommen, die mögliche Rolle Deutschlands bei der Überwindung der Eurokrise zu definieren, ein ebenfalls kurz gehaltener Blick auf den Zustand der EU.
Die EU hat es in den letzten 20 Jahren nicht geschafft, die selbst gesetzten Ziele zu erreichen. Im März 2020 haben die europäischen Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel in Lissabon ein Programm verabschiedet, mit dem die EU bis zum Jahr 2010 zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen“. Ziel war es, die Produktivität und Innovationskraft relativ zu Japan und vor allem den USA zu verbessern.
Nachdem die Ziele nicht erreicht wurden, verabschiedete die EU eine „Nachfolge-Strategie“, um bis 2020 die Ziele doch noch zu realisieren: „EUROPA 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum.“[vi] Doch der Erfolg blieb aus.
- Die Forschungsausgaben sollten EU-weit bei drei Prozent vom BIP liegen. Tatsächlich betragen sie 2,07 Prozent. Nur Schweden, Österreich, Dänemark und Deutschland liegen über der geforderten Schwelle.[vii]
- Auch bei der Anzahl der Patente relativ zur Bevölkerungszahl liegen die Staaten der EU deutlich hinter den Wettbewerbern in Asien, den USA aber auch der Schweiz.[viii]
- Nur zwölf der führenden 100 Technologiekonzerne der Welt haben ihren Sitz in einem EU-Land. In den USA sitzen 45, in Japan und Taiwan jeweils 13.[ix]
- Die Zahl der Schulabbrecher sollte EU-weit nicht mehr über zehn Prozent liegen. Deutschland, aber noch mehr Spanien, Portugal und Italien rangieren deutlich über dem Niveau.
- Es ist nicht gelungen, Universitäten aus der EU in den Top 20 der weltbesten Universitäten zu haben. Nach dem Brexit befindet sich keine EU-Universität unter den Top 20, Kopenhagen ist auf Platz 26.[x]
- Auch vom Ziel eines Breitbandanschlusses für jedermann im Jahr 2013, sehr viel höheren Internet-Geschwindigkeiten –30 Mbps (oder mehr) – bis 2020 und einen Internetanschluss von über 100 Mbps für 50 Prozent oder mehr aller europäischen Haushalte sind wir weit entfernt.
- Das Wachstum der Produktivität war in der EU noch schlechter als beim Rest der Welt. Seit dem Jahr 2000 stieg das reale Pro-Kopf-Einkommen in Süd-Korea um 63 Prozent, in den USA um 27 Prozent und sogar in Japan um 17 Prozent. Die Niederlande sind das einzige der größeren EU-Länder, das mit einem Zuwachs von 18 Prozent halbwegs mithalten kann. Frankreich und Spanien schafften 14 Prozent, Deutschland 13 Prozent und in Italien sank das Pro-Kopf-Einkommen seit dem Jahr 2000 real um drei Prozent![xi]
Es dürfte unstrittig sein, dass die EU in den letzten Jahren an Wettbewerbsfähigkeit verloren, nicht gewonnen hat. Als Indikator mag die Entwicklung des Anteils am Welt-BIP dienen: Er muss sinken, weil die Schwellenländer, namentlich China und Indien, so stark aufholen. Dennoch zeigt der Marktanteilsverlust der EU von weit über 20 Prozent auf heute rund 16 Prozent deutlich, dass sie aufgrund des Versagens bei der Erhaltung von Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft auf der internationalen Bühne rasch an Gewicht verliert.
Für die Bürger bedeutet das konkret, dass ein wesentliches Versprechen der EU nicht eingelöst wird: die Schaffung von weiterem Wohlstand. Im Gegenteil, die EU steht vor denselben existenziellen Herausforderungen wie Deutschland: absehbar schrumpfende Erwerbsbevölkerung, ungedeckte Versprechen für die alternde Gesellschaft in Billionenhöhe[xii], fehlende Produktivitätszuwächse und Innovationskraft.
Nicht wenige Beobachter sehen deshalb die EU auf dem Weg in ihr eigenes „japanisches Szenario“. In der Tat sind die Parallelen zu Japan immer deutlicher – neben den bereits genannten, auch die hohe Verschuldung und die fehlende Bereitschaft, ein offensichtlich krankes Bankensystem ernsthaft zu sanieren. [xiii]
Investoren und Finanzmärkte stellen sich immer mehr darauf ein. Dabei hinkt der Vergleich mit Japan in entscheidenden Dimensionen:
- Die EU ist nicht ein einzelner Staat, sondern ein Zusammenschluss verschiedener Staaten, die zunehmend mehr auf die eigenen Interessen achten.
- Die Bevölkerungen der Mitgliedsländer sind nicht so homogen und vermutlich auch nicht so leidensbereit wie die Japaner.
- Der Euro legte den Mitgliedsländern ein straffes Gerüst an, das Anpassungen noch schwerer machte und deshalb das japanische Szenario weiter verschärft.
- Packen wir dazu noch das Versagen der Politik, eine strategische Antwort auf den sich verschärfenden Migrationsdruck – hier Schrumpfvergreisung, jedoch vor unseren Toren Bevölkerungsexplosion – zu finden, sind wir nicht weit von einer existenziellen Krise der EU entfernt.
Trotz aller berechtigten Kritik an der EU, ist es jedoch in unserem größten Interesse, eine Krise und einen perspektivisch absehbaren Zerfall der EU zu verhindern.
Deutschland muss führen, aber anders als früher
Die wirtschaftliche Logik für eine enge Zusammenarbeit der Europäer liegt auf der Hand. Gemeinsam haben sie politisch international mehr Gewicht, der Binnenmarkt ist der größte der Welt und damit stellt sich jedes Land besser als allein.
Der Austritt Großbritanniens widerspricht dieser Logik offensichtlich. Dennoch kam es bekanntlich zum Brexit und auch wenn es Hoffnung gibt, das Land künftig nahe an der EU zu halten – gerade wegen der enormen militärischen Bedeutung und der engen Handelsbeziehungen –, ist der Austritt ein Warnsignal für die EU. Scheitert sie weiter dabei, den theoretischen Nutzen praktisch zu realisieren und für die Bürger spürbar zu machen, wird der Druck wachsen. Ein wirtschaftlich erfolgreiches Großbritannien nach dem Austritt ist zweifellos einer der größten Albträume in Brüssel.
Deutschland muss deshalb seine in den letzten Jahren für gewöhnlich abwartende Rolle aufgeben und versuchen, die EU und eng damit verbunden, den Euro zu sanieren. Dies aber meiner Meinung anders, als es hier politisch diskutiert wird. Ein breiter Konsens unter deutschen Politikern lautet: Wir brauchen mehr Integration bei jedem Problem der EU und wir sollten bereit sein, mehr in den Gemeinschaftstopf einzuzahlen. Begründet wird das mit dem großen wirtschaftlichen Nutzen, den wir aus der EU (und dem Euro) zögen.
Abgesehen davon, dass es mit dem wirtschaftlichen Nutzen keineswegs so eindeutig ist, wie behauptet[xiv], sind erhebliche Zweifel angebracht, dass die Probleme der EU mit mehr Umverteilung und mehr Integration wirklich zu lösen sind. Die Argumentation der Politik erinnert an den Philosophen Paul Watzlawick, der treffend feststellte, dass, wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, in jedem Problem einen Nagel sieht. Für die EU und die EU-fokussierten Politiker ist die Antwort auf jede Krise ein „Mehr“ an Integration. Doch das ist weder richtig, noch entspricht es den Wünschen der Bevölkerung.[xv] Aus diesem Grunde muss die EU dringend umsteuern, will sie sich selbst erhalten und den Nutzen für die Bürger, den es gibt.
Mit dem Weggang Großbritanniens fehlt auf Ebene der EU eine wichtige Stimme für den Gedanken des Wettbewerbs, der Marktwirtschaft und der Subsidiarität. Die Mehrheit der Mitgliedsstaaten steht in einer eher planwirtschaftlichen und zentralistischen Tradition. Nicht zufällig hat der Ökonom Hans-Werner Sinn gefordert, den Vertrag von Lissabon zu ändern, um den veränderten Stimmgewichten in der EU nach dem Austritt Rechnung zu tragen. Ohne Großbritannien liegt die Mehrheit der Stimmen eher bei den südlichen Ländern und Frankreich.
 Für Deutschland bedeutet dies, dass wir uns nicht mehr wie früher hinter den Briten verstecken können, wenn es um bestimmte Themen geht. Vor allem bei Budgetfragen und Versuchen, mehr Macht nach Brüssel zu verlagern, war in dieser Hinsicht auf die Briten Verlass. Da es offensichtlich ist, dass die Probleme der EU sich nicht einfach nur durch mehr Geld und mehr Zentralisierung lösen lassen, muss nun Deutschland die Rolle der ökonomischen Vernunft einnehmen. Ein erheblicher Rollenwechsel – dessen bin ich mir bewusst – aber nur so dürfte es gelingen, die EU erfolgreich in die Zukunft zu führen.
Für Deutschland bedeutet dies, dass wir uns nicht mehr wie früher hinter den Briten verstecken können, wenn es um bestimmte Themen geht. Vor allem bei Budgetfragen und Versuchen, mehr Macht nach Brüssel zu verlagern, war in dieser Hinsicht auf die Briten Verlass. Da es offensichtlich ist, dass die Probleme der EU sich nicht einfach nur durch mehr Geld und mehr Zentralisierung lösen lassen, muss nun Deutschland die Rolle der ökonomischen Vernunft einnehmen. Ein erheblicher Rollenwechsel – dessen bin ich mir bewusst – aber nur so dürfte es gelingen, die EU erfolgreich in die Zukunft zu führen.
Konkret bedeutet dies natürlich, dass wir zunächst unsere Hausaufgaben im Inland machen. Denn nur, wenn wir den Wohlstand und die Wirtschaftskraft Deutschlands erhalten, hat die EU eine Zukunft. Die Erwartung, dass künftig die anderen Länder Transfers nach Deutschland leisten, ist eine Illusion. Ohne ein starkes Deutschland ist die EU Geschichte.
Damit haben wir aber auch den erforderlichen Hebel für Reformen. Diese umfassen:
- Steigerung des Wirtschaftswachstums durch Strukturreformen, die den Namen verdienen. Weitere zehn Jahre, in denen die EU, die selbst gesteckten Ziele nicht erreicht, können wir uns nicht leisten.
- Priorität auf Schaffen von Wohlstand durch eine Änderung der politischen Agenda der EU. Das heutige Zielsystem fokussiert auf Regulieren, Planwirtschaft (siehe Klimapolitik) und Unterdrücken von Wettbewerb.
- Dezentralisieren statt Zentralisierung von Entscheidungen in Europa. So viel Subsidiarität wie möglich. Programm für das Rückführen von Aufgaben auf das Niveau der Nationalstaaten.
- Bund von Nationalstaaten statt Superstaat durch Aufgabe der Idee der zunehmenden Zentralisierung. Die Bürger müssen mehr an Entscheidungen beteiligt werden.
- Mehr Wettbewerb statt weniger zwischen den Mitgliedsländern. Es muss sich lohnen, Initiative zu ergreifen und den eigenen Standort zu stärken. Gerade der intensive Wettbewerb der Länder Europas in den vergangenen Jahrhunderten dürfte ein Grund für den wirtschaftlichen Aufstieg der Region gewesen sein.
- Wirksames Begrenzen der Zuwanderung durch Schutz der Außengrenzen und Orientieren der Zuwanderung an den eigenen ökonomischen Interessen.
- Demokratisieren der Institutionen: Es kann es nicht sein, dass die Stimmen der einzelnen Bürger im EU-Parlament so unterschiedliches Gewicht haben. Dies geht vor allem dann nicht, wenn man dem Parlament mehr Rechte einräumen möchte.
Zielbild wäre eine EU, die sich auf wenige Kernaufgaben beschränkt, vor allem den Binnenmarkt, gemeinsamen Schutz der Außengrenzen und Verteidigung. Dieser Wandel wäre möglich, allerdings setzt er eine Abkehr der EU-Eliten vom bisherigen Kurs voraus. Wahrscheinlicher ist, dass die EU am bestehenden Kurs festhält und damit scheitert – mit weitaus verheerenderen Konsequenzen als ein freiwilliger Wandel je haben könnte.
Zwingende Voraussetzung für eine Reform der EU muss eine Korrektur des Eurofehlers sein. Denn wie gezeigt, bewirkt der Euro mehr eine wirtschaftliche – und damit absehbar auch politische – Spaltung der EU als eine engere Bindung. Zwar ist die Eurokrise erst mal vom billigen Geld der EZB unterdrückt, doch kann auch die EZB die zugrunde liegenden Probleme damit nicht lösen. Wir brauchen eine Lösung, die die unzureichende Wettbewerbsfähigkeit einzelner Mitgliedsländer und das Problem der hohen Verschuldung von Staaten und Privaten bereinigt.
Keine einfache Fragestellung, vor allem aus Sicht der Politik, da jeder Versuch in Richtung einer Lösung zu gehen, höchst unpopulär sein dürfte. Deshalb auch das derzeitige Spiel auf Zeit, in der Hoffnung, dass ein Wunder geschieht und das Problem verschwindet. Das wird aber nicht passieren.
Seit Jahren plädiere ich für einen europäisch koordinierten Schuldenschnitt. Mittlerweile hat sich die EZB so weit von ihrem ursprünglichen Mandat – Sicherung der Geldwertstabilität – entfernt. Maßnahmen wie Helikopter-Geld, also die direkte Finanzierung von Staatsausgaben durch die EZB, sind absehbar. Deshalb liegt es nahe, die Idee eines europäischen Schuldenfonds wieder aufzugreifen. Dabei vereinen die Euroländer Staats- und Privatschulden oberhalb eines bestimmten Niveaus in einem gemeinsamen Topf, der von der EZB refinanziert wird. Dabei kann die Notenbank auf Zins und Tilgung verzichten und so die Schulden faktisch ausbuchen. Diese Überlegung findet international immer mehr Anhänger und dürfte von der Bank of Japan als erste der großen Notenbanken schon in diesem Jahrzehnt vorgemacht werden. Die Eurozone sollte denselben Weg gehen.
Ich weiß, dass derartige Überlegungen gerade in Deutschland auf heftigen Widerspruch treffen. Vor allem wird es als ungerecht empfunden, wenn jenen, die sich selbst in Not gebracht haben, so geholfen wird. Auch befürchtet man eine Wiederholung. Dem könnte man entgegentreten, in dem Deutschland ebenfalls entsprechend Schulden in den Fonds einbringt und zum anderen, in dem man die Verträge der EU und des Euro so klärt, dass es eindeutig eine Einmalaktion bleibt.
Außerdem sollte die EU einführen, dass Parallelwährungen in den Mitgliedsländern ermöglicht werden, eventuell sogar in allen. Der Euro bliebe erhalten, aber es wäre ein halbwegs eleganter Weg, um eine größere Schwankungsbreite zwischen den Währungen und damit ein Ventil zur Anpassung wieder zu öffnen, das seit der Euroeinführung verstopft ist. Schnell würden die lokalen Währungen dominieren.
Der Traum der Europäer, neben dem US-Dollar eine dominierende Weltwährung zu schaffen, ist gescheitert. Der Euro hat heute einen Anteil an den Weltwährungsreserven, der dem der D‑Mark vor der Euroeinführung entspricht. Der praktische Nutzen einer einheitlichen Währung ist in der heutigen Welt globaler Kapitalmärkte begrenzt, können Unternehmen sich doch gegen Wechselkursrisiken absichern.
Die Alternative zur faktischen Auflösung der Eurozone wäre eine verkleinerte Währungsunion jener Länder, die ökonomisch gut zusammenpassen. Um Deutschland herum wären das vor allem die Niederlande und Österreich. Frankreich ist als Grenzfall zu sehen.
Ist es nicht möglich, den Euro auf diese Weise geordnet abzuwickeln, sollte Deutschland den Schwerpunkt der Anstrengungen auf die Reformen der EU und den Schuldentilgungsfonds legen. Höhere Wachstumsraten dank höherer Produktivität und Innovationskraft in allen Mitgliedsländern, könnten helfen, den Euro zu stabilisieren. Wahrscheinlich ist dies angesichts der Entwicklungen der letzten Jahre nicht.
[i] Internationaler Währungsfonds, „Economic Convergence in the Euro Area: Coming Together or Drifting Apart?“, 23. Januar 2018, abrufbar unter: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/23/Economic-Convergence-in-the-Euro-Area-Coming-Together-or-Drifting-Apart-45575
[ii] Bei Griechenland ist allerdings anzumerken, dass die Schulden real deutlich geringer sind, wenn man sie statt zu nominellen Werten zu Marktpreisen bewertet. Dies liegt daran, dass Zinsen und Tilgungen sehr großzügig vereinbart wurden, worin ein faktischer, aber für die Bürger der Kreditgeberländer, allen voran wir Deutschen, nicht offensichtlicher Schuldenerlass liegt. Nachzulesen bei beyond the obvious, „Die Lüge von der gewinnbringenden Rettung“, Juni 2018, abrufbar unter: https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/best-of-bto-2018-griechenland-die-luege-der-gewinnbringenden-rettung/
[iii] Flossbach von Storch, „Die lateinische Münzunion – ein Präzedenzfall für den Euro“, 16. Mai 2019, abrufbar unter: https://www.flossbachvonstorch-researchinstitute.com/fileadmin/user_upload/RI/Studien/files/studie-190516-die-lateinische-muenzunion.pdf
[iv] Deutsche Bank, „Understanding Euro-Zone break-up – How much would the Euro drop”, 9. März 2017, abrufbar unter: https://think-beyondtheobvious.com/wp-content/uploads/2017/03/DB-Understanding-Eurozone-break-up-09.03.17.pdf
[v] Internationaler Währungsfonds, „Towards a fiscal Union for the Euro Area“, 25. September 2013, abrufbar unter: https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Toward-A-Fiscal-Union-for-the-Euro-Area-40784
[vi] Europäische Kommission, „EUROPA 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“, 3. März 2010, abrufbar unter: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20%20DE%20SG-2010–80021-06–00-DE-TRA-00.pdf
[vii] Eurostat, „Leichter Anstieg der FuE-Ausgaben in der EU im Jahr 2017 auf 2,07 % des BIP“, 10. Januar 2019, abrufbar unter: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9483602/9–10012019-AP-DE.pdf/054a5cb0-ac62-4ca4-a336-640da396b817
[viii] WIPO World Intellectual Property Organization, „World Intellectual Property Indicators 2019“, abrufbar unter: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf
[ix] Thomson Reuters: „The Top 100 Global Technology Leaders“, abrufbar unter: https://www.thomsonreuters.com/content/dam/ewp‑m/documents/thomsonreuters/en/pdf/reports/thomson-reuters-top-100-global-tech-leaders-report.pdf
[x] Shanghai Index, „Academic Ranking of World Universities“, abrufbar unter: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html
[xi] Gemäß Daten der Weltbank. Zur Berechnung siehe beyond the obvious, „10 Jahre Lissabon-Vertrag – Wie ist die wirtschaftliche Lage der EU heute? Fakten zum Nachlesen“, 1. Dezember 2019, abrufbar unter: https://think-beyondtheobvious.com/10-jahre-lissabon-vertrag-wie-ist-die-wirtschaftliche-lage-der-eu-heute-fakten-zum-nachlesen/
[xii] European Commission, „Fiscal Sustainability Report 2018“, Januar 2019, abrufbar unter: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip094_en_vol_1.pdf
[xiii] beyond the obvious, „Folgt Europa Japan in das deflationäre Szenario?“, 6. Mai 2019, abrufbar unter: https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/folgt-europa-japan-in-das-deflationaere-szenario‑i/
[xiv] Ausführlich in: Daniel Stelter, „Das Märchen vom reichen Land“, Finanzbuch Verlag, München 2018
[xv] Das ist zumindest der Schluss, den man aus Umfragen ziehen muss. Während 76 Prozent der Deutschen in der Mitgliedschaft in der EU etwas Gutes sehen, sind es nur knapp mehr als 50 Prozent der Franzosen und 36 Prozent der Italiener. Damit ist die Unterstützung nicht so stark, wie man sie erwarten müsste mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen die EU steht. European Parliament, „Spring Eurobarometer 2019“, S. 16, abrufbar unter: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/closer-to-the-citizens-closer-to-the-ballot/report/en-eurobarometer-2019.pdf
Dr. Daniel Stelter –www. think-beyondtheobvious.com
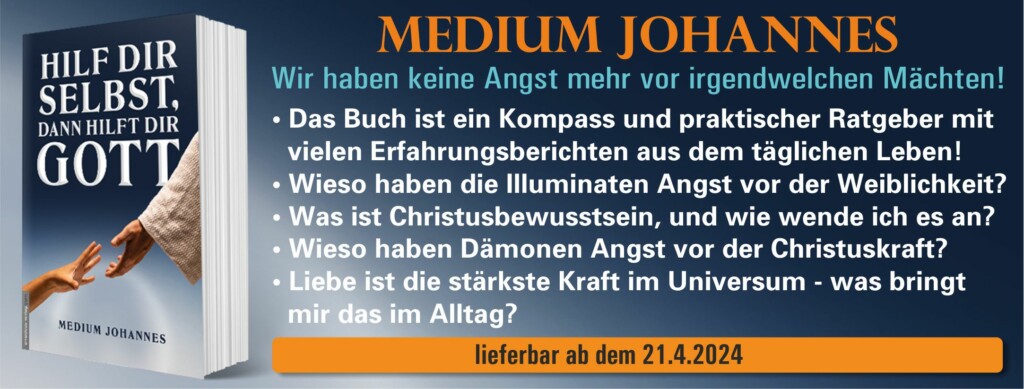




























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.