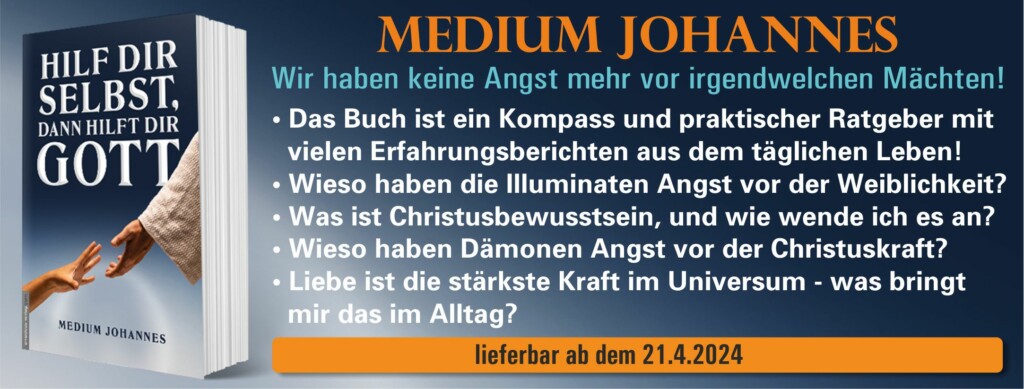Am heutigen Sonntag stimmen die Schweizer über eine radikale Reform des Geldsystems ab. Die Schweiz braucht diese Revolution nicht zwingend. Für den Euro könnte sie die letzte Rettung sein.
Die Schweiz ist ein glückliches Land. Dank der direkten Demokratie und dem Instrument der Volksabstimmung mag es zwar den einen oder anderen Entscheid des Volkes geben, den das politische Establishment nicht schätzt, andererseits kommen Themen in die politische Diskussion, die es bei uns niemals auf die politische Agenda schaffen, obwohl sie es mehr als verdienten, breit und kontrovers diskutiert zu werden.
 So ist es auch bei dem Thema der Volksabstimmung vom kommenden Sonntag. Da sind die Schweizer Bürger gefordert, darüber zu entscheiden, ob die bestehende Geldordnung – wie sie in allen kapitalistischen Systemen weltweit besteht – grundlegend geändert werden soll. Es geht um nichts weniger, als den Banken die Möglichkeit der Geldschöpfung zu nehmen.
So ist es auch bei dem Thema der Volksabstimmung vom kommenden Sonntag. Da sind die Schweizer Bürger gefordert, darüber zu entscheiden, ob die bestehende Geldordnung – wie sie in allen kapitalistischen Systemen weltweit besteht – grundlegend geändert werden soll. Es geht um nichts weniger, als den Banken die Möglichkeit der Geldschöpfung zu nehmen.
Ein Entscheid dafür wäre die Revolution, die Autopionier Henry Ford schon vor mehr als 100 Jahren prophezeite: „Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh.“
Unser Geldsystem gehört hinterfragt!
Die Angst vor dieser Revolution dürfte der wesentliche Grund für die konsequente Vernebelungspolitik von allen Seiten sein. Unser Geldsystem wird nicht offen diskutiert und es werden viele falsche Geschichten zur Entstehung von Geld erzählt. Diese Vernebelung ist so erfolgreich, dass selbst die meisten Banker nicht verstehen, was sie da eigentlich machen.
Dabei lohnt es sich genau hinzusehen, ist es doch gerade unsere Geldordnung die Finanzkrisen, Eurokrise, Blasen und Crashs erst ermöglicht und dabei zu immer größeren Krisen führt.
Obwohl die Zentralbanken der Welt einen anderen Eindruck erwecken, haben sie nur sehr indirekt und schwach Einfluss auf die Entwicklung der Geldmenge, nämlich über den Zinssatz und die geforderte Mindestreserve, die Banken bei ihnen hinterlegen müssen. Dabei folgen sie dem, was das Bankensystem macht – nicht umgekehrt. 90 Prozent allen Geldes, das wir nutzen, wurde so von den privaten Banken geschaffen. Nur die restlichen zehn Prozent stammen von den Notenbanken.
Wenn die Bank einen Kredit gewährt, kann sie dies tun, ohne zuvor eine Spareinlage bekommen zu haben. Sie schafft das Geld also aus dem Nichts ‒ lateinisch „fiat“, weshalb man von einem Fiat-Geldsystem spricht. Dies ist so lange nicht problematisch, wie der Kredit gegen vernünftige Sicherheit gewährt wird, denn dann steht dem neu geschaffenen Geld ein entsprechender Vermögenswert entgegen. Das Geld ist also durch ein werthaltiges Asset gedeckt.
Betrachtet man die Banken nicht als neutrale Vermittler zwischen Ersparnissen und Investitionen, wie dies viele Lehrbücher heute noch tun, erkennt man, dass Banken einen erheblichen prozyklischen Einfluss auf die Wirtschaft haben. In guten Zeiten, in denen die Einkommen sicher und die Vermögenspreise hoch sind beziehungsweise weiter steigen, geben Banken gerne Kredit. In schlechten Zeiten hingegen halten sie sich zurück. Das prozyklische Verhalten der Banken führt dabei nicht nur zu einer regelmäßigen Abfolge von Booms und Krisen, sondern tendenziell zu immer größeren Krisen.
Blicken wir auf die letzten 40 Jahre zurück, so sehen wir eine konstant steigende Verschuldung der westlichen Welt, die sich zudem ungebremst fortsetzt. Dies ist so zu erklären: Banken vergeben zunächst Kredite an solvente Schuldner mit guten Sicherheiten. Damit wächst die Geldmenge. Die Wirtschaft läuft gut, die Einkommen steigen und auch die Vermögenspreise gehen nach oben. Kommt es zu einem Abschwung, stellen die Banken fest, dass sie zu großzügig waren. Sie erleiden erste Verluste, die Sicherheiten fallen im Wert und sie halten sich mit neuen Krediten zurück. Banken- und Finanzkrisen sind die zwangsläufige Folge.
 Diese zu verhindern war der Hauptgrund für die Gründung von Zentralbanken die im Krisenfall als „Lender of Last Resort“ einspringen sollten. Allerdings mit harten Auflagen. Der Bankenexperte Walter Bagehot, von 1861 bis 1877 Herausgeber und Chefredakteur des The Economist, hat dazu schon 1873 klare Regeln aufgestellt: Demnach sollte die Zentralbank im Krisenfall nur solventen Banken helfen, gegen die Hinterlegung von sehr guten Sicherheiten, zu einem hohen Strafzins. Mit diesen Regeln wollte er sicherstellen, dass die Banken vorsichtig agieren und ihre Geldschöpfungsfähigkeit nicht missbrauchen, um schlechten Schuldnern gegen unzureichende Sicherheiten Geld zu geben.
Diese zu verhindern war der Hauptgrund für die Gründung von Zentralbanken die im Krisenfall als „Lender of Last Resort“ einspringen sollten. Allerdings mit harten Auflagen. Der Bankenexperte Walter Bagehot, von 1861 bis 1877 Herausgeber und Chefredakteur des The Economist, hat dazu schon 1873 klare Regeln aufgestellt: Demnach sollte die Zentralbank im Krisenfall nur solventen Banken helfen, gegen die Hinterlegung von sehr guten Sicherheiten, zu einem hohen Strafzins. Mit diesen Regeln wollte er sicherstellen, dass die Banken vorsichtig agieren und ihre Geldschöpfungsfähigkeit nicht missbrauchen, um schlechten Schuldnern gegen unzureichende Sicherheiten Geld zu geben.
Mit Blick auf die Finanz- und Eurokrise und vor allem auf die derzeitige „Eurorettungspolitik“ müssen wir feststellen, dass die genannten Grundsätze alle über Bord geworfen werden. Die EZB gibt Banken, die faktisch insolvent sind, Kredite gegen fragwürdige Sicherheiten, zu einem Zinssatz von null. Dies zeigt, wie schlimm es um das Finanzsystem im Jahre zehn der Krise bestellt ist.
Initiative will Bankenprivileg beenden
So sehen das nicht etwa nur Kritiker aus dem linken Spektrum. Die der Bankenfeindlichkeit sicherlich unverdächtige Financial Times hielt kürzlich fest, dass wir uns sicherlich ein anderes Geldsystem gegeben hätten, hätten wir es bewusst entwickelt. Martin Wolf, der renommierte Chefvolkswirt der Zeitung forderte schon 2014: „Strip Private Banks of their Power to create Money„.
Am letzten Mittwoch (also nach Veröffentlichung meines Kommentars beim Manager Magazin) hat Wolf in der FT übrigens nochmals nachgelegt: → FT (Anmeldung erforderlich): „Why the Swiss should vote for ‘Vollgeld’“, 5. Juni 2018
Die Grundidee ist, den Banken das Recht zur Geldschöpfung zu nehmen und dieses nur noch der Notenbank zu überlassen. Ein solches Geldsystem nennt man englisch „Sovereign Money“, auf Deutsch etwas blumiger „Vollgeld“.
Am letzten Mittwoch (also nach Veröffentlichung meines Kommentars beim Manager Magazin) hat Wolf in der FT übrigens nochmals nachgelegt: → FT (Anmeldung erforderlich): „Why the Swiss should vote for ‘Vollgeld’“, 5. Juni 2018
Die Grundidee ist, den Banken das Recht zur Geldschöpfung zu nehmen und dieses nur noch der Notenbank zu überlassen. Ein solches Geldsystem nennt man englisch „Sovereign Money“, auf Deutsch etwas blumiger „Vollgeld“.
Hier setzt die Volksinitiative in der Schweiz an. Unter dem Eindruck der für die Schweizer traumatischen Rettung der Großbank UBS wollen die Initiatoren den privaten Banken jegliche Geldschöpfung verbieten. Die Banken wären gezwungen, ihre Kundeneinlagen in voller Höhe bei der Zentralbank zu halten. Sie wären in diesem System die Verwahrer von Notenbankgeld und könnten nur dann Kredite vergeben, wenn die Sparer zuvor der Bank einen Kredit geben – und zwar explizit, nicht nur dadurch, dass sie ihr Geld auf dem Girokonto stehen lassen.
Die Idee von Vollgeld und staatlichem Geldmonopol ist nicht neu und hatte in der Vergangenheit prominente Unterstützer wie Benjamin Franklin, David Ricardo, Thomas Jefferson und später den Nobelpreisträger Milton Friedman. 1936 wurde der Umstieg vom existierenden System zum Vollgeldsystem von den Professoren Henry Simons und Irving Fisher als „Chicago Plan“ entwickelt. Die beiden Professoren sahen darin einen Weg, dass Geldwachstum (= Kreditwachstum) einer Volkswirtschaft zu stabilisieren und Zyklen aus Boom und Krise zu verhindern. Gescheitert ist die Idee nicht zuletzt am Lobbyismus der Banken und an der einsetzenden Erholung der Wirtschaft von der großen Depression.
Gute Gründe dafür und dagegen
Dabei ist unser Geldsystem eigentlich eine geniale Erfindung, dessen wirtschaftliche Effizienzgewinne sich kaum abschätzen lassen. Das sogenannte Fiat Money war ein wichtiger Motor für die Entwicklung der modernen Volkswirtschaften. Banken sollten besser als jede zentrale Institution Risiken beurteilen können. Durch die Vergabe von Krediten gegen gute Sicherheiten, sollte das neu geschaffene Geld werthaltig und zugleich knapp sein. Da die Banken zudem ein Interesse am eigenen Überleben haben, sollten sie vorsichtig agieren mit ausreichendem Eigenkapital und umsichtiger Kreditvergabe an solide Schuldner. Vor allem Investitionen sollten finanziert werden. So zumindest die Theorie und auch die Argumente der Gegner eines Systemwechsels.
In der Praxis haben wir das System pervertiert. Konkursrisiken wurden für Banken weitgehend abgeschafft.  Kredite werden überwiegend zum Kauf vorhandener Vermögenswerte – Immobilien! – und zur Spekulation verwendet. Staaten und Notenbanken haben alles darangesetzt, das System zu entfesseln. Immer mehr Kredit soll die Weltwirtschaft am Laufen halten. Immer mehr Kredite sind auch erforderlich, um die bereits ausstehenden Kredite zu bedienen.
Kredite werden überwiegend zum Kauf vorhandener Vermögenswerte – Immobilien! – und zur Spekulation verwendet. Staaten und Notenbanken haben alles darangesetzt, das System zu entfesseln. Immer mehr Kredit soll die Weltwirtschaft am Laufen halten. Immer mehr Kredite sind auch erforderlich, um die bereits ausstehenden Kredite zu bedienen.
 Kredite werden überwiegend zum Kauf vorhandener Vermögenswerte – Immobilien! – und zur Spekulation verwendet. Staaten und Notenbanken haben alles darangesetzt, das System zu entfesseln. Immer mehr Kredit soll die Weltwirtschaft am Laufen halten. Immer mehr Kredite sind auch erforderlich, um die bereits ausstehenden Kredite zu bedienen.
Kredite werden überwiegend zum Kauf vorhandener Vermögenswerte – Immobilien! – und zur Spekulation verwendet. Staaten und Notenbanken haben alles darangesetzt, das System zu entfesseln. Immer mehr Kredit soll die Weltwirtschaft am Laufen halten. Immer mehr Kredite sind auch erforderlich, um die bereits ausstehenden Kredite zu bedienen.
Natürlich könnten wir die „Untergangsmaschine der Banken“ (Martin Wolf) stoppen, indem wir deutlich höhere Eigenkapitalquoten fordern, eine strengere Regulierung durchsetzen und letztlich auch Konkurse zulassen. Allen Beteuerungen der Politik zum Trotz ist hier nichts passiert. Gerade in Europa sind die Banken noch genauso gefährlich wie vor zehn Jahren.
Das wäre ein weitaus besseres Feld für Reformvorschläge für den französischen Präsidenten, statt die letztlich untauglichen Ideen mit mehr Umverteilung die Eurozone eine Runde weiter zu bekommen. Doch auch er hätschelt lieber die französischen Banken (deren absehbaren Verluste in der Türkei europäisch sozialisiert werden sollen), statt die Grundursache der Eurokrise, die überbordende Geld-Kredit-Schöpfung eines entfesselten Bankensystems zu stoppen.
Aus Frustration über dieses Politikversagen kann man die Befürworter der Umstellung auf Vollgeld gut verstehen. Es wäre in der Tat ein überlegenes System, ist doch die Geldversorgung einer Wirtschaft ein öffentliches Gut. Eine Verstaatlichung des Geldsystems, in dem Sinne, dass nur die Notenbank über das Wachstum der Geldmenge entscheidet und nicht mehr inhärent prozyklische private Banken hat daraus ihre Berechtigung. Die Notenbank könnte die Geldmenge stetig wachsen lassen und sich dabei am nachhaltigen Wachstumspotenzial der Wirtschaft orientieren. Die Abfolge von Boom und Krise bliebe uns erspart und im Falle einer Schieflage im Finanzsystem käme es zu keinem Bankenrun, wären doch alle Einlagen von der Notenbank besichert.
Ich selbst bin bei dem Thema hin und her gerissen. Ich sehe den Nutzen der Vollgeld-Lösung, traue jedoch unseren Notenbanken nicht. In den letzten 30 Jahren haben sie alles getan, um das prozyklische Verhalten der Banken zu belohnen und zu fördern. Ohne die einseitige Politik der expliziten und impliziten Bail-outs und der ständigen Zinssenkungen wäre es niemals zur Finanzkrise gekommen. Wieso diese Notenbanken es nun in Zukunft besser machen sollen, verschließt sich mir. Dennoch ist es unstrittig, dass sich an unserem Geldsystem etwas ändern muss.
Entschuldung für die Eurozone
Die Schweiz braucht die Umstellung auf Vollgeld ohnehin nicht so dringend wie die Eurozone. Dies liegt an zwei Gründen. Zum einen ist das Bankensystem des Landes heute weitaus solider finanziert. Zum anderen braucht das Land nicht die finanzielle Nebenwirkung der Aktion: nämlich den einmaligen Umstellungsgewinn in Milliardenhöhe, der vom Staat zur Schuldentilgung verwendet werden kann.
Genau das braucht aber die Eurozone. Wie an dieser Stelle immer wieder ausgeführt, benötigt die Eurozone einen Schuldenschnitt für staatliche und private Schulden in der Größenordnung von drei bis fünf Billionen Euro. Da diese Summe nicht so einfach aufzutreiben ist, gehen alle Maßnahmen der „Euroretter“ in zwei Richtungen:
- Erhöhung der Verschuldungskapazität durch „Einbindung“ des deutschen Steuerzahlers (Eurobudget, Eurofinanzminister, Bankenunion, etc.)
- Monetarisierung der Schulden durch die EZB, die dazu Staatsanleihen in Billionenumfang aufkauft und perspektivisch erlassen soll.
Das Problem mit dieser Strategie ist, dass 1 nicht funktioniert und 2 zu lange dauert. Bevor 2 umgesetzt ist, haben wir in allen Ländern der Eurozone „populistische“ Regierungen.
Hier kann die Umstellung auf Vollgeld helfen. Schon 1936 erwarteten die Autoren des Chicago Plans einen einmaligen Gewinn der US-Notenbank aus der Umstellung. 2012 rechneten zwei Forscher im Auftrag des IWF nach und kamen zum gleichen Ergebnis. Die Umstellung würde im Beispiel der USA zu einer völligen Entschuldung des Staates führen und zugleich eine deutliche Reduktion der privaten Verschuldung ermöglichen.
 Wie das? In einem ersten Schritt müssen die Banken sämtliche Ausleihungen zu 100 Prozent mit Einlagen decken. Da sie das bisher nicht tun, müssen sie sich das dazu erforderliche Geld bei der Zentralbank leihen. Statt heute nur wenige Prozente (Mindestreserve), würde die Zentralbank die Ausleihungen zu 100 Prozent refinanzieren. Folge ist eine erhebliche Bilanzverlängerung des Bankensystems.
Wie das? In einem ersten Schritt müssen die Banken sämtliche Ausleihungen zu 100 Prozent mit Einlagen decken. Da sie das bisher nicht tun, müssen sie sich das dazu erforderliche Geld bei der Zentralbank leihen. Statt heute nur wenige Prozente (Mindestreserve), würde die Zentralbank die Ausleihungen zu 100 Prozent refinanzieren. Folge ist eine erhebliche Bilanzverlängerung des Bankensystems.
Da die Notenbank dem Staat gehört, wäre der Staat dann Kreditgeber und Schuldner zugleich, halten die Banken doch im erheblichen Umfang Staatsanleihen. Verrechnet man diese Forderungen der Banken gegen den Staat mit den Verbindlichkeiten gegenüber der Notenbank, kommt es wieder zu einer Verkürzung der Bilanz. Bezieht man die nicht von Banken gehaltenen Staatsanleihen mit ein, ist der Staat damit schuldenfrei. Im Fall der USA würde es sogar eine teilweise Tilgung der privaten Schulden ermöglichen, da der Finanzsektor in Summe Verbindlichkeiten von rund 200 Prozent des BIP hat. In Europa wäre der Effekt deutlich größer, ist doch der Bankensektor mit rund 300 Prozent vom BIP viel aufgeblähter.
Letztlich handelt es sich um eine „Monetarisierung“ der bestehenden Schulden. Das muss keineswegs inflationär sein, da Inflation sich nur aus einer Mehrnachfrage und damit letztlich Kreditwachstum ergibt. Ohnehin läuft die derzeitige Strategie der Notenbanken über den Aufkauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren, im Fachjargon „Quantitative Easing“ genannt, auf eine Monetarisierung hinaus.
Bei der Umstellung auf Vollgeld könnte jedoch glaubhafter gemacht werden, dass es sich um eine einmalige Aktion handelt und nicht um den Einstieg in eine dauerhafte Finanzierung des Staates durch die Notenbank. Lediglich das laufende Geldmengenwachstum würde über die Zuweisung von Geld an den Staat erfolgen. Alternativ und noch besser wäre die Zuteilung an jeden Bürger direkt.
Ein Trick, der funktioniert
Damit wären wir bei einem Trick, der funktionieren könnte. An dieser Stelle möchte ich nochmals betonen, dass ich mir das alles nicht wünsche. Ich bin nur Realist dahin gehend, dass die Politik alles Erdenkliche unternehmen wird, um das politische Projekt Euro gegen alle ökonomischen Gesetze durchzuhalten. Da geht es mir dann um die Schadensminimierung.
Die Politik könnte den Systemwechsel gut begründen:
- Die Eurokrise wäre nie passiert, hätte es nicht den Kreditboom in den heutigen Krisenländern gegeben. Dieser Kreditboom war ausgelöst von Banken, die nur auf den eigenen Profit geschaut haben, ohne die Wirkung auf die Gesamtwirtschaft zu bedenken.
- Der EZB und der Politik war es nicht möglich, hier gegenzusteuern, weil in unserem bestehenden Geldsystem, die Geldschöpfung fast ausschließlich bei den privaten Banken liegt.
- Damit haben wir eine Privatisierung der Gewinne bei gleichzeitiger Sozialisierung der Kosten. Das wollen wir nicht mehr hinnehmen.
- Banken sollen sich in Zukunft auf ihre Rolle als Kreditvermittler beschränken, wo sie über die beste Expertise bei der Beurteilung von Risiken verfügen.
- Die EZB wird in Zukunft alleinig über das Wachstum der Geldmenge entscheiden, und zwar in Abhängigkeit vom nachhaltigen Potenzialwachstum. Es gibt keine aktive Geldpolitik mehr, weil diese in dem neuen System nicht mehr erforderlich ist.
- Damit ist das Euro-Bankensystem sicher und wir brauchen weder eine Bankenunion noch einen Mechanismus für die Rettung von Staaten.
- Der beim Systemwechsel entstehende einmalige Gewinn ist nur die gerechte Entschädigung der Steuerzahler für die früher eingegangenen Kosten für die Rettung der Banker.
- Deshalb wird der Gewinn dazu genutzt, alle Staatsschulden der Euro-Mitgliedsländer zu tilgen. Das verbleibende Guthaben verwenden wir zu einer prozentual gleichen Kürzung aller anderen ausstehenden Schulden.
Denkbar? Ich glaube ja. Es könnte auch funktionieren. Die offene Frage bleibt, ob ein solches System das Vertrauen der Bevölkerung genießen würde. Voraussetzung ist, dass der Staat mit der nun gegebenen Möglichkeit der monopolisierten Geldschaffung vorsichtig umgeht. Zu groß ist die Gefahr, dass die Politik der Versuchung nicht widerstehen wird, durch großzügiges Geldmengenwachstum Scheinblüten zu erzeugen und damit die Krisen noch zu vergrößern.
Diesem Argument halten die Autoren des IWF-Papiers zwei Punkte entgegen: Erstens könne man in einem Vollgeldsystem die Geldpolitik nicht Kriminellen überlassen, die wie der Schotte John Law in Frankreich zwischen 1717 und 1720 überteuerte Aktien für vermeintliche Goldminen in der Kolonie Louisiana ausgab, wo sich tatsächlich nur Sümpfe und Alligatoren fanden. Zweitens könne und sollte man in einem Vollgeldsystem keine Kriege führen, geschweige denn verlieren. In beiden Fällen ist das Wachstum der Geldmenge viel zu hoch und eine Entwertung die zwangsläufige Folge. Ich würde noch addieren, dass man auch nicht überzogene Versprechen für Sozialleistungen und Altersversorgung abgeben sollte.
Da Letzteres der Fall ist, bleibt wohl nur die nüchterne Erkenntnis, dass die Umstellung auf Vollgeld der Eurozone einen Neustart ermöglichen könnte, jedoch nichts an der Unfähigkeit der politischen Akteure ändert.
Dr. Daniel Stelter — www.think-beyondtheobvious.com
→ manager-magazin.de: „Die Schweizer Lösung für die Eurokrise“, 5. Juni 2018
Und hier die Übersetzung:
→ positive money: „THE SWISS SOLUTION TO THE EURO CRISIS“, 7. Juni 2018
→ manager-magazin.de: „Die Schweizer Lösung für die Eurokrise“, 5. Juni 2018
Und hier die Übersetzung:
→ positive money: „THE SWISS SOLUTION TO THE EURO CRISIS“, 7. Juni 2018