Landwirtschaft ist überall auf der Welt eine Wette gegen das Wetter, und schon jetzt bedrohen extreme Dürren samt Wasserknappheit, die Getreideernten. Extreme Dürre, der Verbrauch von Wasser steigt auf Rekordhöhe. Nein, diese Meldung stammt nicht aus Afrika, sondern aus Europa. Nach dem Bericht des Weltklimarates IPCC wird die globale Erwärmung allgemein dazu führen, dass global die trockenen Gebiete trockener werden. Das trifft auch auf Europa als Ganzes zu. Und in der Tat, sind laut Dürremonitor die Böden in einigen Regionen Deutschlands schon wieder zu trocken. Ein Grund, welches auch Bayer dazu nutzen könnte, endlich sein Wundermittel gegen Dürre gewinnbringend auch in Deutschland zu verkaufen.
Schon lange versucht der umstrittene Konzern Monsanto, der von Bayer übernommen wurde, seine genetisch veränderten Pflanzen, die gegen Dürre resistent sein sollen, als Wunderlösung für die Ernährungssicherheit zu verkaufen. In anderen Ländern ist Bayer mit seiner Wunderlösung gescheitert, so wie in Afrika. Afrika gilt als Testgebiet für den Genmais und daher wird der Genmais auch als „Ein Mais für Afrika“ bezeichnet. „Gute Erträge auch bei Dürre“ heißt es und wird mit Entwicklungshilfe gefördert. Doch nicht nur Tansania, sondern auch Südafrika haben diese Lüge entlarvt. Es hat sich herausgestellt, dass der genveränderte Mais bei extremer Dürre sogar schlechtere Erträge bringt. Und nicht nur der Mais ist genmanipuliert, sondern sogar Obst und Gemüse. Und nicht vergessen, genmanipulierte Sorten, wie Getreide oder sogar Kartoffeln, kommen nie alleine, sondern auch im Gepäck sind gesundheitsgefährdende Pestizide wie Glyphosat. In nur 100 Jahren gingen aufgrund von Monokulturen über 75 Prozent der biologischen Vielfalt verloren. Pflanzen, Insekten und Organismen sind für die Nahrungsmittelproduktion von entscheidender Bedeutung, doch diese Artenvielfalt geht verloren. Die UN-Lebensmittelbehörde warnt deshalb vor der Bedrohung der weltweiten Nahrungsmittelproduktion durch mangelnde Artenvielfalt in der Umwelt. Wer die Debatten über die Landwirtschaft in den letzten zehn Jahren verfolgt hat, wird feststellen: Durch die industrielle Landwirtschaft gibt es Wasserverunreinigung und ‑verschwendung, Luftverschmutzung, Bodenvernichtung und Schäden bei der lokalen Wirtschaft. Industrielle Landwirtschaftsbetriebe behaupten, sie würden den Hunger in den armen Ländern der Welt beenden – doch der Großteil der Nahrungsmittel, die in Entwicklungsländern angebaut werden, wird in reiche Länder exportiert! Eine andere Welt ist pflanzbar, das spüren bereits in den USA auch große Konzerne. Denn ein neuer Trend zur Individualität trifft Nestlé, Unilever, Mondelez, General Mills oder Kraft Heinz gleichermaßen. Jungen Start-ups dagegen kommt er zugute. Gerade die Silicon-Valley-Milliardäre investieren lieber in “gesunde Ernährung” statt Konzerne, die für ihr Junkfood bekannt sind. Und ein Mann, der schon vor Jahren erkannte, dass sich die Landwirtschaft ändern muss, ist Paul Kaiser. Paul Kaiser zeigt mit seinem kleinen Hof, wie er trotz der Dürre reichlich erntet. Dieser kalifornische Landwirt hat eine Methode ohne Genmanipulation und Pestiziden gefunden, Nutzpflanzen in Dürregebieten anzubauen! Kaisers System ermöglicht es ihm, fünf bis sieben Ernten pro Jahr zu ernten.
Der neue Trend in den USA – „gesund Essen“

Jeder, der an Amerika denkt, denkt automatisch an Fastfood und ungesunde Ernährung. Waren Fastfood-Ketten ein Teil des American Way of Life, so setzen die an Fast-Food gewohnten Amerikaner immer stärker auf gesunde Lebensmittel. Bio-Supermärkte sprießen im ganzen Land wie Pilze aus dem Boden.
Immer mehr Restaurants können es sich nicht mehr leisten, nichts Gesundes auf der Karte zu haben, und sie preisen diese auch mit der Kalorienzahl an und mit dem Zusatz „Wellness“. Sogar in Schulen werden mittlerweile 100% biologische Mahlzeiten angeboten – alles Produkte aus nachhaltigem Anbau und frei von genveränderten Organismen. In den USA hat sich seit einigen Jahren ein medial sehr präsentes Gesundheitsbewusstsein entwickelt. Der Kampf gegen Übergewicht – vor allem bei Kindern – wird offensiv angegangen. Dass Colas und andere Softdrinks absolute Kalorienbomben sind, wird den meisten Kindern bereits in der Schule beigebracht, dementsprechend sehen auch die Umsätze der Konzerne aus, die „ungesunde“ Lebensmittel anbieten – sie gehen zurück. Wer als Konzern nun nicht aufpasst und dem Verbraucher nicht biologische Lebensmittel anbietet, hat verloren.
Gerade die Silicon-Valley-Milliardäre investieren lieber in „gesunde Ernährung“. So gründete Elon Musks Bruder ein Farm-to-Table-Restaurant, das Gerichte für 5 $ anbietet und Organic fast-food drive-thru joint wurde vom Berufs-Basketball-Spieler Ray Allan gegründet.
Oder das Beispiel von Andreessen Horowitz, eine private amerikanische Risikokapitalfirma, die 2009 von Marc Andreessen und Ben Horowitz gegründet wurde. Weil sie als vielbeschäftigtete Unternehmer nicht mehr über Lebensmittel nachdenken wollten und für sie eine gesunde Ernährung wichtig war, gründeten die beiden ein eigenes Unternehmen mit dem Namen Soylent. Sie investierten 20 Millionen US-Dollar.
Mit Standorten in Kalifornien, Colorado, Illinois, Nevada, Tennessee, New York City und Texas wurde Lyfe Kitchen mit Sitz in Palo Alto im Jahr 2011 gegründet und es gewinnt seitdem immer mehr an Bedeutung und zahlreiche neue Investoren.
Schulspeisungen sind bekanntlich weit davon entfernt, nahrhaft zu sein, aber Revolution Foods hat dies geändert. Dieses Unternehmen stellt pro Woche mehr als eine Million gesunde und frische Mahlzeiten her und serviert Lebensmittel, die frisch verarbeitet werden. haben keinen Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, künstliche Aromen oder Zusatzstoffe. Revolution Foods sorgt dafür, dass Kinder in der Schule eine angemessene Ernährung erhalten (insbesondere Kinder, die an kostenlosen und reduzierten Mahlzeiten teilnehmen), was eine sehr gute Sache ist, das fand auch der Mitbegründer von AOL, Steve Case und investierte 30 Millionen US-Dollar in das Unternehmen.
Allerdings setzt sich dieser Trend vom „gesunden Essen“ nicht unbedingt in Deutschland fort, wie eine aktuelle Studie zeigt

Die Deutschen sehen sich als Pioniere für gesunde Ernährung und nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und glauben, dass die Menschen in anderen Ländern sich dieser Problematik weniger bewusst sind. Doch das Gegenteil ist der Fall: Während die US-Amerikaner schon länger Fast Food meiden, steigt der Umsatz in Deutschland. Auch andere Länder achten vermehrt auf gute Ernährung. Mexiko war sogar das erste Land, welches etwas gegen das „Dickwerden“ seiner Bürger unternommen hat. In allen Ländern kaufen beispielsweise rund zehn Prozent der Verbraucher Biofleisch. In Deutschland ist die Entscheidung für Biofleisch eher ein Wunschdenken. Die Deutschen sind für ihre offensichtlichen Widersprüche bekannt.
Das Verbraucherverhalten im 21. Jahrhundert ist von Natur aus widersprüchlich: Sie möchten alles haben – höchste Qualität und ökologische und ethische Produktion – und gleichzeitig die günstigsten Preise. Genau damit beschäftigt sich auch die Werbung und sie hat sich darauf spezialisiert, Schnäppchenjäger und Bio-Fans, obwohl ein deutscher Widerspruch, zu „befriedigen“. Dies mit Erfolg, es reicht ein tolles Siegel, dazu noch Aktionspreis und so kauft der Deutsche die Ware, die eigentlich als ungesund gilt. Ob nun Pizza aus der Kühltruhe oder schnell ein Snack bei McDonalds und Burger King, nicht nur die Pfunde steigen, sondern auch der Umsatz.
Laut Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung werden in Deutschland auf gerade mal 1% der landwirtschaftlich genutzten Fläche werden Obst und Gemüse angebaut. Nimmt man den Anbau von Kartoffeln hinzu, sind es 2%. Übrigens nimmt auch der Deutsche Spargel viel Platz ein und zwar rund 22.400 Hektar. Das entspricht rund 18 Prozent der bundesdeutschen Anbaufläche von Gemüse im Freiland. Dieser Spargel wird übrigens exportiert, während Spargel aus Peru und sogar China importiert wird. Deutschland kann sich nicht selber ernähren, davor wurde Deutschland sogar schon mehrfach von der Weltorganisation für Ernährung gewarnt.
Da alles billig angebaut werden soll, wird vieles auch in Afrika angebaut. Da aber in diesen Ländern eine schreckliche Dürre herrscht, kommt es zu Lieferengpässen.
Mega-Dürre bedroht Kalifornien

Reflection: A Walk with Water
Wasser spielt hier in Kalifornien eine große Rolle. Es geht nicht nur um das Vorhandensein oder Fehlen von Regen, obwohl das wichtig ist. Seit über 100 Jahren werden riesige Wassermengen aus dem Central Valley und dem Colorado River umgeleitet, um Los Angeles und Umgebung mit Wasser zu versorgen. Genau, damit beschäftigt sich eine neuer Dokumentarfilm: Reflection: A Walk with Water– „Ein Spaziergang mit Wasser“.
In Reflection: A Walk with Water (Ein Spaziergang mit Wasser) wandert der Filmemacher Emmett Brown mit einer Gruppe die gesamte Länge des Aquädukts vom heutigen trockenen Owens Lake Bed bis zu den Kaskaden, die die Berge hinunter in die Stadt führen. Entlang des Weges überlegen er und andere, was diese Umleitung von so viel Wasser das Land gekostet hat.
Die Bedingungen, die Leben ermöglichen, ändern sich schnell. Der 30-jährige Filmemacher rechnet mit dieser Realität an der Schwelle zu einer weiteren Trockenzeit, die seine Gemeinde verwüsten könnte, und begibt sich auf eine bemerkenswerte Reise. Und er trifft auf seiner Reise auch auf Singing Frogs Farm, die Farm von Paul Kaiser. Paul Kaiser zeigt mit seinem kleinen Hof, wie er trotz der Dürre reichlich erntet.

Singing Frogs Farm
Kennen Sie Paul Kaiser und seine Singing Frogs Farm?
Wir hatten Ihnen Paul Kaiser bereits schon vorgestellt. Doch da auch Europa das Wasser ausgeht, zeigen wir Ihnen, wie Paul Kaiser mit der „Dürre tanzt“.

Erst im März 2023 fand ein Workshop für Climatefarmschool statt und Paul Kaiser schreibt auf Facebook: „Nichts ist so frühlingshaft wie ein praktischer Workshop zum Thema Direktsaat. “
Mittlerweile sind Paul Paul und Elizabeth Kaiser von der Singing Frogs Farm in Sebastapol, Kalifornien, in ganz USA bekannt und waren auch die Hauptredner der 30. jährlichen NOFA/Mass Winter Conference. Ihre Gemüsefarm ist nicht nur nachhaltig – sie ist auch regenerativ.
Wir haben Paul Kaisers Geschichte aus dem CRAFTSMANSHIP Magazine übersetzt, denn Landwirtschaft geht auch anders, ohne GVO und Pestizide!

Der mit der Dürre tanzt – Paul Kaiser galt als umstrittener kalifornischer Landwirt, der die wirksamste Methode gefunden hat, Nutzpflanzen in einem sich erwärmenden Klima anzubauen?
Eines Nachmittags im vergangenen März versammelte sich eine Gruppe von Landwirtschaftsexperten um einen 1,20 m hohen stählernen Pfosten auf einem kleinen Hof, den Paul Kaiser in einem besonders kühlen Tal in Sebastopol betreibt. Die Experten waren gekommen, um Tiefe und Qualität von Kaisers oberster Erdschicht zu testen. Einer von ihnen, der altgediente Landwirt Tom Willey, lehnte sich auf den Pfosten, um ihn so tief in die Erde zu stoßen wie möglich. Normalerweise stößt man mit dem Pfosten nach weniger als 30 cm auf harten unfruchtbaren Untergrund. Aber auf Kaisers Feld ließ sich der gesamte Pfosten in die Erde drücken, wobei Willey fast hinfiel. „Wow, das ist unglaublich“, sagte er und überlegte, ob er vielleicht das Loch eines Erdhörnchens erwischt hatte. „Noch mal! Noch mal!“, sagte Jeff Mitchell, langjähriger Professor für Landwirtschaft an der der kalifornischen Universität in Davis.
 Die Gruppe wiederholte die Übung immer wieder mit Erfolg, um Fotos zu machen und um sicherzugehen, dass Kaiser wirklich die tollen Dinge angewendet hatte, über die er spricht und die er fast unaufhörlich tut, was nicht gerade einfach ist. Kaiser, ein übersprudelnder früherer Holzarbeiter von erst 40 Jahren, bewirtschaftet nur 3,2 Hektar Land und erntet nur auf circa einem Hektar. Nichtsdestoweniger stehen seine Methoden an vorderster Stelle einer (zumindest in den USA) neuen Farmer-Bewegung, die angesichts einer klimatisch sich verändernden Welt mit geringeren Niederschlägen gegründet wurde, um enorme neue Möglichkeiten zu eröffnen und zu etablieren. Man könnte diese Methode als nachhaltig auf der Basis von Steroiden (Pflanzenwachstumshormonen) bezeichnen, weil sie einen beträchtlichen Gewinn erzeugen kann. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Kaisers Farm im Sonoma County mehr als 100.000 $ pro Acre und damit das Zehnfache des durchschnittlichen Einkommens vergleichbarer kalifornischer Farmen. Dazu gehören auch Sonomas legendäre Weinberge, die schon vor Jahrzehnten Farmland übernommen hatten, weil Weintrauben heutzutage viel lukrativer als Ackerfrüchte sind, wenigstens bei der Methode, nach der die meisten Farmer sie anbauen.
Die Gruppe wiederholte die Übung immer wieder mit Erfolg, um Fotos zu machen und um sicherzugehen, dass Kaiser wirklich die tollen Dinge angewendet hatte, über die er spricht und die er fast unaufhörlich tut, was nicht gerade einfach ist. Kaiser, ein übersprudelnder früherer Holzarbeiter von erst 40 Jahren, bewirtschaftet nur 3,2 Hektar Land und erntet nur auf circa einem Hektar. Nichtsdestoweniger stehen seine Methoden an vorderster Stelle einer (zumindest in den USA) neuen Farmer-Bewegung, die angesichts einer klimatisch sich verändernden Welt mit geringeren Niederschlägen gegründet wurde, um enorme neue Möglichkeiten zu eröffnen und zu etablieren. Man könnte diese Methode als nachhaltig auf der Basis von Steroiden (Pflanzenwachstumshormonen) bezeichnen, weil sie einen beträchtlichen Gewinn erzeugen kann. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Kaisers Farm im Sonoma County mehr als 100.000 $ pro Acre und damit das Zehnfache des durchschnittlichen Einkommens vergleichbarer kalifornischer Farmen. Dazu gehören auch Sonomas legendäre Weinberge, die schon vor Jahrzehnten Farmland übernommen hatten, weil Weintrauben heutzutage viel lukrativer als Ackerfrüchte sind, wenigstens bei der Methode, nach der die meisten Farmer sie anbauen.
Kaiser erreicht dies alles, ohne auch nur einen Quadratzentimeter seines Bodens zu pflügen, ohne Unkraut zu jäten und ohne zu sprühen — egal ob Chemie oder Organisches. Während die meisten Landwirte, sogar solche von organischen Vorzeigefarmen, ständig mit verschiedenen Düngercocktails „herumbasteln“, konzentriert sich Kaiser nur auf eines: auf einen Haufen verrottender Lebensmittel und Pflanzen, gemeinhin als Kompost bekannt, und zwar recht viel davon. Kaiser behandelt dann diesen Kompost durch eine seltene Mischung von sowohl alten als auch neuen landwirtschaftlichen Verfahren, die alle nur das Ziel haben, organischen Abfall und Schmutz in den reichhaltigsten, fruchtbarsten Saatboden zu verwandeln, der möglich ist. „Es ist einzigartig“, erzählte Mitchell mir nach seinem Besuch. „Ich habe nie zuvor etwas gesehen, das auch nur annähernd daran kommt“.
Kaisers Farm mag winzig sein im Vergleich zu den Mega-Farmen, die heute die meisten Amerikaner ernähren. Aber alle von Kaisers Methoden werden in gewisser Weise von weitaus größeren Betrieben innerhalb und außerhalb der USA angewendet— mit wachsendem Erfolg. Kaiser kombiniert all diese Verfahren an einem Ort und steigert einige von ihren ins Extrem und hat dadurch seine Farm in ein ungewöhnliches und zunehmend umstrittenes Feldexperiment verwandelt. Wenn man seinen Erfolg bei diesem Experiment bis jetzt beurteilt, könnte Kaiser vielleicht nicht alle „Gleichungen gelöst“ haben, wie er denkt. Was aber zählt, ist der Ehrgeiz seiner Bemühungen — und seine Zielorientierung. Vielleicht kann man solche Bemühungen und ihre erreichten Ziele als Organische Landwirtschaft 2.0 bezeichnen, weil die standardgemäßen Verfahren organischer Landwirtschaft bisher ihre Umweltziele nicht erreicht haben.
„Bei einigen der organischen Farmen sind die Böden unglaublich zerstört“, sagte mir kürzlich Ray Archuleta, ein Agronom des US-amerikanischen Landwirtschaftsministeriums. Der Grund, den Archuleta mir nannte, verstößt eigentlich gegen jede Intuition: Während sie Chemikalien vermeiden, halten die meisten organischen Landwirte an im Wesentlichen künstlichen Kulturmethoden fest, die größtenteils darin bestehen, den Boden mit Eggen und Pflügen aufzureißen, so wie es konventionelle Landwirte tun, um ihn dann bis zur nächsten Saison liegenzulassen. Sie verbrauchen auch zu viel Wasser. Um Archuletas Aussage zu untermauern: In den fünf Jahren, seit Kaiser aufhörte, seine Felder zu pflügen, verbrauchte er halb so viel Wasser zur Bewässerung seiner Felder, bis hin zu einer Stunde pro Woche, während seine Felder immer mehr hergaben. Inzwischen bewässert er nur noch mit einen Tropfensystem mithilfe von dünnen Plastikröhrchen, während einige seiner organischen Nachbarkollegen immer noch Sprinkler verwenden, die massive Wassermengen verbrauchen, von denen ein großer Teil durch Verdunstung verlorengeht.
Das ist großartig. Wie jeder inzwischen weiß, erlebt Kalifornien gerade eine historische Dürreperiode. 2014 war das bisher heißeste dokumentierte Jahr. In der Panikwelle im ganzen Bundesstaat verfielen verzweifelte Farmer darauf, auf eigene Kosten nach Quellen zu bohren. Infolge all dessen sank in Kalifornien der Grundwasserspiegel, sodass in einigen Gegenden Kaliforniens landwirtschaftliche Flächen brach lagen. In einigen Gemeinden des Haupttals sank der Boden so stark, dass ein örtlicher Damm um circa einen Meter innerhalb von fünf Jahren absank. Im mittleren Westen sind die Umstände nicht viel besser. Die „Dust Bowl“ (Staubschüssel) der der großen Depression in den 1930er-Jahren wiederholt sich gerade an ziemlich denselben Orten, die sie auch damals traf: den östlichen Teil von Colorado, Neu-Mexiko, Nebraska, Texas, Kansas und Oklahoma.
Die Dürre ist der offensichtlichste Grund für diese Probleme. Aber die geringen Regenfälle heben das Problem hervor und erschweren es, ein Problem, das jahrzehntelang gewachsen ist: die stetige Ausdünnung des fruchtbaren amerikanischen Bodens. „Ich hätte niemals geglaubt, die „Dust Bowl“ wieder erleben zu müssen“, sagt Archuleta. „Wir haben Billionen Dollar ausgegeben und sind noch keinen Schritt weiter. Was geht hier vor?“
Die Frage, die Archuleta aufwirft, entwickelt sich als vorrangig, wie Wetteraufzeichnungen des amerikanischen Westens deutlich aufzeigen. Im Jahr 2014 gab es in Kalifornien praktisch keine Regenniederschläge bis zum Dezember. Als die ersten endlich kamen, waren sie sintflutartig und erbrachten in manchen Gebieten die achtfache Menge der für den Monat normalen Menge. Immerhin war es so warm, dass es kaum Schnee auf den Bergen gab — eine Katastrophe, denn Schnee ist sehr wichtig, um Kalifornien während der langen trockenen Sommermonate bewässern zu können.
Nach den frühen Regensintfluten im Dezember herrschte wieder die übliche Trockenheit. Gemäß den Klima-Experten wird dieses Muster wohl zur neuen Norm und es wird eher noch schlimmer im Verlauf der folgenden Jahre. Drei namhafte Vorhersagen (zwei davon von US-Agenturen und eine aus Japan) stellten kürzlich fest, dass 2014 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war.
Diese Dürreperioden sind nicht nur ein Problem der Westküste. Kalifornien galt lange als der vorrangige „Supermarkt“ des Landes, der mehr als 90 Prozent seiner Artischocken, seines Selleries, Knoblauchs, seiner Pflaumen, Kiwis und Walnüsse produziert und mehr als 50 Prozent von praktisch jeder anderen Frucht und jedem anderen Gemüse, das gegessen wird. Wenn man Kaisers Farm aus dieser Perspektive sieht, erkennt man ganz klar die Bedeutung von seiner Arbeit.

Singing Frogs Farm
Die Weisheit der Wälder
Ich traf Kaiser zum ersten Mal im letzten Herbst bei einer Konferenz zur Erhaltung der Landwirtschaft im Napa Valley, bei der er sein Konzept vorstellte. Er trug einen australischen Cowboyhut aus Leder, der so abgewetzt war, dass der Faden seiner Krempe seine Augen verhüllte wie ein kaputter Lampenschirm. Kaiser hatte 10 Minuten zur Verfügung, um in einem Nebenforum sein Konzept vorzustellen, für das er eigentlich zwei Stunden benötigt. Die Beschränkung schien jedoch kein Problem zu sein. Kaiser liebt Zahlen, die sein Gehirn schneller ausspuckt, als sein Mund sie formulieren kann. In seinen Vorträgen übt man das schnelle Zuhören, so als ob man bei einer Bandaufnahme den schnellen Vorlauf eingibt. Er gibt dramatische Aussagen von sich, die eher zu einem Träumer der 1960er-Jahre passen würden. Einige wirken erst ein bisschen wackelig, aber die meisten erweisen sich nach Prüfung als wissenschaftlich solide bewiesen.
[Fotounterschrift] Dank seines Systems kann Kaiser fünf bis sieben Mal pro Jahr ernten. Die meisten Farmer schätzen sich glücklich, wenn sie zwei schaffen.
Ehe Kaiser seinen Vortrag im Napa Valley beendete, präsentierte er der kleinen Zuhörerschaft Dias, die die negativen Auswirkungen organischer Sprühverfahren zeigten, den überwältigenden Gegensatz zwischen der Fruchtbarkeit seiner Felder und der seiner Nachbarn und haufenweise Statistiken der Regierung und solche von Universitäten. (Laut einer Zeitschrift, die er präsentierte, ist die Landwirtschaft für 30 Prozent der Treibhausgase verantwortlich; laut einer anderen könnten 89 Prozent von diesen durch bessere Anbaumethoden vermieden werden. Eine weitere kam zu dem Schluss, dass die Landwirtschaft ihre Beiträge zu den Treibhausgasen viel billiger reduzieren könne als andere Industriezweige.) Als eine Frau unter den Zuhörern Rat suchte und ihn fragte, wie sorgfältig er alte Pflanzenüberbleibsel er während der Ernte entsorgt, rasselte er eine lange Erklärung herunter, warum er deren Wurzeln an Ort und Stelle lässt. (in Kürze, um den Würmern Nahrung zu geben, die wiederum den Boden ernähren). Kaiser beendete seinen Vortrag mit einer ehrgeizigen Definition von landwirtschaftlicher Nachhaltigkeit — und benutzte dazu eine Kreisgrafik mit drei Segmenten. „Nachhaltige Landwirtschaftsmethoden sind nur ein Bereich“, sagte er. „Wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist ein zweiter und die soziale ein dritter“.
 Kaiser stellt sich eine Welt vor, in der jede Stadt von kleinen gesunden Farmen umgeben ist wie der seinen — sogar in den trockensten Regionen der Erde. Er schätzt, dass der höhere Ertrag, den diese Farmen erwirtschaften können, es ihnen erlaubt, mehr Arbeiter einzustellen, und dass die Arbeiter kommen, weil die Arbeit qualifiziert, Vollzeit und gut bezahlt ist. Kaiser argumentiert, dass das, was Menschen weltweit am meisten benötigen, gute Arbeitsstellen sind. Rein zufällig war es genau das Argument, das niemand anderer als die Weltbank, die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie die Vereinten Nationen in einem entsprechenden Bericht im Herbst 2014 veröffentlichten. Kaiser glaubt so sehr an diese Zukunft und sein Modell, dass er seine Visionen „missioniert“, wo immer er die Gelegenheit bekommt — bei Konferenzen und Gemeindeveranstaltungen, in seinen Newslettern und gegenüber Besuchern seiner Farm.
Kaiser stellt sich eine Welt vor, in der jede Stadt von kleinen gesunden Farmen umgeben ist wie der seinen — sogar in den trockensten Regionen der Erde. Er schätzt, dass der höhere Ertrag, den diese Farmen erwirtschaften können, es ihnen erlaubt, mehr Arbeiter einzustellen, und dass die Arbeiter kommen, weil die Arbeit qualifiziert, Vollzeit und gut bezahlt ist. Kaiser argumentiert, dass das, was Menschen weltweit am meisten benötigen, gute Arbeitsstellen sind. Rein zufällig war es genau das Argument, das niemand anderer als die Weltbank, die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie die Vereinten Nationen in einem entsprechenden Bericht im Herbst 2014 veröffentlichten. Kaiser glaubt so sehr an diese Zukunft und sein Modell, dass er seine Visionen „missioniert“, wo immer er die Gelegenheit bekommt — bei Konferenzen und Gemeindeveranstaltungen, in seinen Newslettern und gegenüber Besuchern seiner Farm.
Diese Missionierungen werden von manchen Farmern in Sonoma und anderswo nicht so gern gesehen. Sie schätzen seine großsprecherischen Vergleiche nicht. Einige beschreiben ihn als „Besserwisser“. Einige glauben, dass sein System ökologisch gefährlich sei. Anderen finden nichts Besonderes bei den Praktiken, die er feilbietet. „Es hört sich an wie ein großer Garten“, sagte mir Ed Thompson, langjähriger Direktor des American Farmland Trust. „Wie viele solcher klitzekleiner Farmen benötigen wir denn dann, um uns zu ernähren? Könnte unser Wirtschaftssystem so etwas unterstützen? Gäbe es genügend willige Farmarbeiter?“ Für Warren Weber, einen der ersten großem organischen Farmer des Staates und den bekannten Gründer der Star Route Farms in Bolins, ist Kaiser einfach nur naiv. „Es gibt nicht DEN vollkommenen Weg“, sagte Weber. „Er wird sich sehr verändern, während er weiter Landwirtschaft betreibt“. Immerhin glauben einige andere, dass Kaiser etwas Gutem auf der Spur ist. Immer wieder kommen Menschen auf seine Farm und suchen Rat beim Versuch, sein System selbst zu verwirklichen, und einige wenige haben dabei bereits ihr Einkommen gesteigert. Sogar der amerikanische Kongress gab 2013 eine Empfehlung zu seiner Arbeit. Bei einem kürzlichen Sonntag-Regionalmarkt wandten sich Vertreter dreier verschiedener landwirtschaftlicher Organisationen an Kaiser und baten ihn um Rat oder Hilfe bei ihren Bemühungen. Inzwischen quellen die Säle über, wenn Kaiser als Redner angekündigt wird. Im Januar 2015 sprach er vor einem vollen Saal bei der EcoFarm Conference in Pacific Grove, Kalifornien. Seit 1981 findet dieses fünftägige innovative Festival statt, das sich zur größten Veranstaltung über nachhaltige Landwirtschaft im amerikanischen Westen überhaupt entwickelt hat. Während Kaiser bei früheren Veranstaltungen eher über Sondergebiete gesprochen hatte, stellte er hier nun zum ersten Mal sein komplettes System vor. Hörbar schnappten die Zuhörer nach Luft, wenn er von seinen astronomischen Profiten oder dem astronomischen Ausmaß seiner Bodenfruchtbarkeit sprach.
Die Situation ähnelt der eines Predigers, der das Evangelium verkündet.
Schon als Kind war Kaiser von Erde besessen, weiß seine Mutter. War diese Neigung genetisch bedingt? Obwohl seine Familie immer noch Kürbisse in Illinois für Libby’s anbaut, wuchs Kaiser selbst in einer nordkalifornischen Vorstadt auf. Mit 20 suchte Kaiser, ein muskulöses Bündel von Energie und Neugier, nach dem Geheimnis eines gesunden Pflanzenlebens. Er nährte seine Suche durch eine Reihe rastloser Studien, die ihm höhere akademische Grade einbrachten in den Bereichen Internationale Beziehungen, Verwaltung natürliche Ressourcen und nachhaltige Entwicklung. Eine seiner ersten gärtnerischen Forschungen nahm er 1998 in Westafrika vor während einer Aufgabe für das Friedenskorps. Kaiser wurde nach Gambia geschickt, einem kleinen Land nahe der Sahara, das einst einer der großen Player im Sklavenhandel war. Seine Aufgabe war es, die ausgedörrte Landschaft wiederzubeleben, die er mit einer Kombination von Land- und Forstwirtschaft (agro-forestry) in Angriff nahm.
Obwohl heute kaum praktiziert, ist Land-Forstwirtschaft eine Jahrhunderte alte Methode, die auf einem sehr einleuchtenden Prinzip basiert: Wenn man mit einer Auswahl an Bäumen beginnt, die alle verschiedene Aufgaben übernehmen können — Windschutz und Mulch z. B. oder das Bewahren von Wasser, von Nährstoffen oder Bodenkrume—wird Fruchtbarkeit die Folge sein. Kaiser sammelte zuerst Baumsamen und pflanzte sie überall. Auch errichtete er einen kleinen Versuchsgarten mit Gemüsesorten, die die Dorfbewohner nie oder nur selten zuvor gesehen hatten—Kohl, Paprika und etwas Salat.

Kaisers Äcker von etwas mehr als zwei Acres ist nach den Standards der meisten Landwirte ein ungeordnetes Sammelsurium — keine großen, weiten, sorgfältig gepflügten Felder; keine endlosen Reihen von immer denselben Ackerfrüchten. Jedoch erkennen immer mehr Landwirte, dass wenn sie eine Mischung von Früchten pflanzen und sie mit Bäumen, Büschen, Blumen umgeben und den unzähligen Insekten, die diese anziehen — dann wächst die Produktivität.
Gambia leidet sowohl unter sengender Hitze als auch unter geringem Regen. Die einzige verlässliche Wasserquelle in Kaisers Gemeinschaft war ein 35 m tiefer Brunnen. Darum folgte Kaiser einer leider meist missachteten Grundregel: Schütze deinen Boden. „Ich nahm alles, was ich an Ästen, Zweigen und Blättern noch in den fast zerstörten Wälder finden konnte“, sagt Kaiser, „und warf sie auf die Gartenbeete. Den Rest wird das Leben selbst übernehmen“. (So romantisch diese Behauptung klingen mag, funktioniert diese Maßnahme aus einfachen biologischen Gründen: Boden, der abgedeckt ist, bleibt feuchter und kühler; dadurch bilden Pflanzen ihre Wurzeln und deren guten Mikroben näher an der Oberfläche, wo es die meisten Nährstoffe gibt.) Sehr bald stellte Kaiser fest, dass er wesentlich weniger Brunnenwasser brauchte als die Dorfbauern. „Sie müssen 100 Eimer täglich schöpfen, während ich nur 20 alle zwei Tage brauche.“
Während er die Dorffelder weiter entwickelte, verliebte er sich in Elizabeth Johnson, eine Volontärin des benachbarten Friedenskorps, die sich in ihn und seine Mission verliebte. Johnsons Familie stammt aus Holcomb, Kansas — einem trostlosen Flecken des Mittleren Westens von zweifach trauriger Berühmtheit: die Morde, die Truman Capote zu seinem Meisterstück „Kaltblütig“ (In Cold Blood) inspirierten, und ein Teil des verdorrten Landes, das Teil der Dust Bowl wurde. (Bis vor kurzem konnten immer noch Lebensmittelkonserven hinter den Wänden der Familiengarage der Johnsons gefunden werden — sie zeugen noch heute von der katastrophalen Wirkung der Dust Bowl auf die Bewohner.) Während ihrer Zeit in Gambia fiel Johnson, die Abschlüsse in Öffentlicher Gesundheit und Krankenpflege hat, auf, wie sehr die Dorfbewohner darum kämpfen mussten, um von ihrer Ernte so gerade leben zu können. „Wenn sie einen Mangobaum pflanzten, kostete es sie solche Mühe, ihn zu erhalten!“, sagte sie mir. „Dann durchbrach eine Ziege ihren Zaun und zerstörte den Baum, weil sie selbst hungrig war“. Während Kaisers Garten wuchs und gedieh, beobachtete Johnson, wie die örtlichen Bauern zunehmend neugierig wurden. Nach und nach erkannten die Dorfbewohner, dass auch sie etwas anderes anbauen könnten außer Hirse und Erdnüssen, die ihre Grundnahrungsmittel seit Generationen gewesen waren.
In das Herz der Krume
 Schwarzmaler warnen seit Beginn des Ackerbaus vor dem Missbrauch des Bodens, wenigstens seit 5000 v. Chr. Wir wissen aber auch seit 1882, wie man seine Fruchtbarkeit wiederherstellt, denn in diesem Jahr veröffentlichte Charles Darwin eine seiner weniger bekannten Entdeckungen: Der Mutterboden wird durch nichts anderes geschaffen als durch den kleinen, aber feinen Regenwurm, und zwar in einer Menge von 10 bis 20 Tonnen pro Acre. (Regenwürmer erschließen Felsgestein, mischen dabei dessen Mineralien mit Wurzeln, Blättern und anderen biologischen Überbleibseln zu einer schönen, vollwertigen Mahlzeit. Seine Ausscheidungen sind fruchtbare Erde.) Aber wenn diese Erde zu Staub pulverisiert wird, wie es auf der ganzen Erde geschieht, gibt es für den Wurm nichts Verzehrbares mehr darin—oder, im weiteren Sinne, für den Rest des Ökosystems.
Schwarzmaler warnen seit Beginn des Ackerbaus vor dem Missbrauch des Bodens, wenigstens seit 5000 v. Chr. Wir wissen aber auch seit 1882, wie man seine Fruchtbarkeit wiederherstellt, denn in diesem Jahr veröffentlichte Charles Darwin eine seiner weniger bekannten Entdeckungen: Der Mutterboden wird durch nichts anderes geschaffen als durch den kleinen, aber feinen Regenwurm, und zwar in einer Menge von 10 bis 20 Tonnen pro Acre. (Regenwürmer erschließen Felsgestein, mischen dabei dessen Mineralien mit Wurzeln, Blättern und anderen biologischen Überbleibseln zu einer schönen, vollwertigen Mahlzeit. Seine Ausscheidungen sind fruchtbare Erde.) Aber wenn diese Erde zu Staub pulverisiert wird, wie es auf der ganzen Erde geschieht, gibt es für den Wurm nichts Verzehrbares mehr darin—oder, im weiteren Sinne, für den Rest des Ökosystems.
Über die letzten Jahrzehnte haben bodenkundige Wissenschaftler herausgefunden, dass dieses Ökosystem weitaus reichhaltiger ist als alles, was man je an Land oder im Meer gefunden hat. Einige zählten mehr Organismen in einem einzigen Teelöffel Erde, als es Menschen auf der Erde gibt. Andere wie Noah Fierer, ein auf mikrobielle Ökologie spezialisierter Professor der Universität Colorado, fanden, dass die biologische Vielfalt des Bodes so weitreichend ist, dass sie nicht in DNA-Tests erfasst werden kann. Unter einem Mikroskop sieht die Bodenprobe in dem Teelöffel aus wie eine Kreuzung des Amazonas-Dschungels mit einen beliebigen exotischen tropischen Korallenriff, in dem es wimmelt von Algen, Plankton und monströsen Geschöpfen aus einem Jules-Verne-Roman. All diese unsichtbaren Lebewesen arbeiten zusammen, sie stärken den Boden, damit er Wasser halten, Erosion widerstehen, die Pflanzen mit Nährstoffen füttern und ihr Immunsystem stärken kann, und, wie vorhergehende Studien nahelegen, symbiotische Mikroben im menschlichen Verdauungsapparat stimuliert, während wir diese Pflanzen essen, die unser Immunsystem stärken. Unter Berücksichtigung all dessen können Kaiser und die wachsende Zahl seiner Befürworter nicht verstehen, wie wir die Welt unter unseren Füßen behandeln. „Was erschafft Leben?“, fragt Kaiser. „Sonne, Regen und Boden. Nur eines dieser drei Dinge können wir beeinflussen — den Boden. Der Boden kann als einziger hier auf unserem Planeten den Tod aufnehmen und ihn in Leben zurückverwandeln. Und alles, was wir mit ihm angestellt haben, ist, ihn zu zerstören.“ Offensichtlich stimmen die Vereinten Nationen dem zu, denn 2015 wurde gemäß einer UN-Deklaration und „Jahr des Bodens“ erklärt.
Einige Jahre, nachdem er Gambia verlassen hatte, arbeitete Kaiser an seiner Examensreihe in Costa Rica, als ein Kollege, der zwei Obstplantagen mit Zitrusfrüchten studierte, etwas Ungewöhnliches entdeckte. Die erste Plantage. die an einen dichten Wald voller Bäumen, Büsche und wildem Wein angrenzte, war mehr als 90 Prozent weniger von Schädlingen befallen als die zweite Plantage, die sich in einer offenen Ebene befand und eine Meile entfernt war. Das verblüffte Kaiser. „Solch ein Ergebnis kann man nicht einmal mit chemischen Pflanzenschutzmitteln erreichen“, sagt er. „Diese chemischen Sprays töten alles — die Schädlinge und die Nützlinge“. (Nützlinge sind Insekten, die nicht die Ackerfrüchte fressen, sondern sie beim Wachsen unterstützen. Bienen z. B. helfen beim Bestäuben; andere wie Marienkäfer und Gottesanbeterinnen fressen die Insekten, die die Ernte auffressen.) Jeder Landwirt möchte Nützlinge haben; Nach jedem Versprühen von Insektenvernichtern kommen die Schädlinge immer schneller zurück als die Nützlinge. (Biologen erklären dies damit, dass Schädlinge sich schneller und effektiver vermehren und dass sie durch jahrhundertelanges Bekämpftwerden widerstandsfähiger wurden.) Weitere Spritzungen folgen und die Todesspirale geht immer weiter. Paradoxerweise geschieht dieser Prozess unabhängig davon, ob diese Spritzmittel chemisch oder organisch sind.
In Costa Rica erkannten Kaiser und seine Kollegen, dass die schädlingsfreie Plantage dem Schicksal der anderen Plantage aus einem einfachen Grund entging: Die Nützlinge hingen in den Baumblättern nahe der Plantage und konnten so die Ernte erhalten. Während seiner Studien besuchte Kaiser eine Bananenplantage, deren Produktivität um das Doppelte gesteigert werden konnte, indem man den Superbaum Moringa Oleifera anpflanzte, der sowohl Schatten spendete als auch Stickstoff, den wichtigsten Nährstoff für eine Pflanze. Kaiser war so beeindruckt von den unzähligen Kräften dieses Baumes, dass er später ein kleines Buch über sie verfasste. In Kaisers Gehirn manifestierte sich ein Muster. „Wenn man sich zuerst darum kümmert, dass es der Natur insgesamt gut geht“, sagt er heute, „ist die Landwirtschaft leicht.“ Miguel Altieri, Professor für Agroökologie an der kalifornischen Universität Berkeley, kam in anderen Versuchsreihen in verschiedenen Regionen Lateinamerikas zu den gleichen Schlussfolgerungen: In vielen Fällen erlangten Kleinbauern höhere Profite und größere Erträge als konventionelle Bauern, die Chemikalien und andere Hilfen der konventionellen Landwirtschaft einsetzten, indem sie die natürlichen Ressourcen ihrer eigenen Landflächen zur Fruchtbarmachung ihres Bodens nutzten. Besonders dramatisch (im positiven Sinn) ist diese Entwicklung in Kuba, wo man neue Fruchtbarkeit durch die Rückkehr zu alten Anbaumethoden erlangt. (Siehe “Cuba’s Harvest of Surprises,” von Christopher Cook.)
2005 kehrten Kaiser und Johnson schließlich in die USA zurück, um zu heiraten, eine Familie zu gründen und das bisher Gelernte auf ihrem eigenen Land auszuprobieren. Nach einigen Monaten der Suche fanden sie schließlich ihr Zielobjekt: die Singing-Frogs-Farm, ein Gebiet von acht Acres (=3,275 Ha) nahe der Innenstadt von Sebastopol. Es war nicht die naheliegendste Wahl. Die Farm war jahrelang vernachlässigt worden; Sie war kalt und feucht und an einem Hang gelegen, weswegen sich dort die Abwässer aus der Nachbarschaft einfanden. Sie bestand nicht aus weiten Flächen, die einen Reihen-Anbau möglich machten. Anders gesagt: Das ideale Gebiet für Kaiser. „Ich suchte nach einem Ort, den ich heilen konnte“, sagt Kaiser. „Mir war klar, dass ich Dinge anbauen wollte, aber ich hatte keinen Plan davon, was das bedeutete“. Jedoch hatte der Ort auch ein gutes Omen: Auf der anderen Seite der Stadt war die Farm und das frühere Haus des großartigen Pflanzenzüchters Luther Burbank (1849–1926).
2007 beackerte Kaiser sein Land mit allen Werkzeugen, die die Farm vorhielt. Er pflügte den Boden, wie es jeder andere Farmer tut. Da die Farm jahrelang nicht bearbeitet worden war, hatte der einfache Unkrautbewuchs das Land sehr fruchtbar gemacht. Darum erblühte die Farm rasch. Aber auch die Arbeit nahm massiv zu. „Das Unkraut war gewaltig“, sagt Kaiser. „Wir arbeiteten sogar des Nachts mit Scheinwerfern auf dem Feld und jäteten stundenlang!“ Eines Morgens im Frühling sah er eine Keilschwanz-Regenpfeiferin (ein Vogel der Region), die seinen Traktor ankreischte. Nachdem er ein paar Male auf seinem Feld hin- und hergefahren war, wurde ihm klar, dass sie ihre Eier schützen wollte, die in einem Nest unsichtbar im Boden lagen. Als Kaiser anhielt, um sich das genauer anzusehen, bemerkte er alle möglichen Schäden, die sein Pflug verursacht hatte — zerschnittene Regenwürmer und Schlangen, zerstörte Bienenstöcke, wertvolle Wurzeln und Käferkolonien, die jetzt der heißen Sonne ausgesetzt waren. Einige Monate später, als sein Daumen im Motor seines Traktors zerquetscht wurde, hatte er eine Erscheinung: „So etwas werde ich nie wieder machen!“, erinnert er sich. „Es muss einen besseren Weg geben“.
Kaiser nahm seine Studien wieder auf und entdeckte eine gewaltige Menge an Literatur, die die Vorzüge von Direktsaat-Landwirtschaft (Landwirtschaft ohne Bodenbearbeitung) preist — anders gesagt, eine Landwirtschaft ohne Maschinen wie Pflug oder Spaten zum Umgraben des Bodens. Die Praxis erfolgt nach der zweiten oft nicht beachteten Anbauregel: Störe deinen Boden so wenig wie möglich. Immerhin hatte diese Anbaumethode eine überraschend gemischte Bilanz.
Auf der Positivseite steht die Vielzahl wesentlicher Nährstoffe, wenn die Pflanzen zu ergiebigem Kompost verrotten; Die Ballaststoffe verringern auch die Wasserverdunstung, die Erosion und die Reihe verdeckter Schäden, die beide verursachen. Die Bundesregierung nimmt hier kein Blatt vor den Mund. In einem Bericht des Jahres 2010 teilte die USDA (US-Department of Acriculture) mit: „Den Boden zu pflügen ist gleichbedeutend mit einem Erdbeben, einem Hurrikan, einem Tornado und einem Waldbrand, die sich alle gleichzeitig in der Welt der Bodenorganismen ereignen“. Don Tyler, ein Naturschutz-Experte der USDA, führt ins Feld, dass ein Jahr Bodenbearbeitung 25 Jahre Bodenverbesserung durch Direktsaat zerstören kann. Aber diese Methode hat auch ihre negative Seite: Wenn Felder nicht besonders sorgfältig behandelt werden, kann die Produktivität auch sinken. Sie tendiert auch dazu, mehr Pestizide und Herbizide zu benutzen als bei der herkömmlichen Anbaumethode, weil die Pflanzen, die übrig bleiben, irgendwo bleiben müssen. Ironischerweise trifft dies besonders zu, wenn Direktsaat-Farmer versuchen, außerhalb der Hauptwachstumsperiode mehr Fruchtbarkeit zu erlangen suchen, indem sie „Abdeckpflanzen“ einsetzen. (Dazu gehören Pflanzen wie Bohnen und bestimmte Gräser, die den Boden bedeckt halten und die Nährstoffe im Boden belassen, anstatt sie herauszuziehen.) Während der Wintermonate sprühen viele solcher Landwirte immer noch, während „konventionelle“ Nachbarn Ferien dank netter, leerer und brachliegender Felder genießen.
Aber auf Kaisers Farm war Sprühen kein Thema. Was er in Übersee gelernt hatte, imitierte Kaiser, indem er seine Farm mit Baumhecken und Büschen einrahmte, die von jenen Nützlingen geliebt werden. Er baute auch seine eigenen Gewächshäuser. Auf diese Weise konnte er neue Pflanzungen ankurbeln durch Sämlinge, die er gut reifen lassen konnte. Diese sorgten für ständige Ernten, sogar im Winter.
Vorgänge wie diese beinhalten zu viel schlammige Arbeit und fordert zu viel von ihren Böden — so denken die meisten Farmer. Tatsächlich lohnt sich aber diese Arbeit. Je länger die Ackerpflanzen im Boden verbleiben, desto besser für den Boden — weil all solche Jules-Verne-Kreaturen sich von Pflanzenwurzeln ernähren. Das lässt diese zahllosen scheibenförmigen Felder im ganzen Land, die im Winter brach liegen, in neuem Licht erscheinen. Sie ruhen nicht aus, sie sterben. Jerry Hatfield, Erntephysiologe beim landwirtschaftlichen Forschungsdienst der USDA, erklärte mir kürzlich: Wenn ein Farmer gepflügtes Land brach liegen lässt, „lässt Du dein biologisches System verhungern. Ich frage sie immer: ‚Wie würde es Ihnen ergehen, wenn ich Ihnen nur einmal im Jahr Nahrung gäbe?’“ Dieses Prinzip bedeutet für Kaiser einfach nur: „Lass immer die Wurzeln im Boden“.
Danach probierte Kaiser etwas anderes: Statt des standardmäßigen Verteilens von Dünger auf seinen Feldern legte er eine dicke Schicht Kompost oben drauf.

Kaiser beherzigt fanatisch, was er die drei Hauptregeln für Bodengesundheit nennt: Wurzeln so weit wie möglich im Boden lassen. Den Boden so weit bedecken wie möglich. Störe den Boden so wenig wie möglich. Kaiser pflügt nur dann, wenn er alten Boden für eine Neuanpflanzung wiederbelebt. Danach pflügt er nicht wieder. Wenn ein Pflanzenbeet gelegentlich Belüftung benötigt, sticht er mit einem Spaten wie diesem hinein.
Kaisers Weg hat aber auch seine Risiken. Kompost ist eine Art Einbrennsauce der Natur: konzentriert, nährstoffreich, eine hochwirksame Mischung von Pflanzenessenzen. Es beginnt mit einem Eimer voll Abfällen — aus unseren Küchen, aus dem Garten und vom Baumschnitt und manchmal von Misthaufen benachbarter Farmer. Um nutzbar zu werden, müssen all diese Sachen gründlich verrotten; Und wenn sie es erst tun, verwandeln sie sich in eine Art konzentrierter Erde. (Um einen Geschmack für diese Vorgänge zu bekommen, lohnt es sich, “The Bug Whisperer” (Der Insektenflüsterer) von Kristin Ohlson zu lesen.) Trotz seiner Lebendigkeit kann dieses Material für junge Pflanzen zu viel sein, weil es ihre zarten Schösslinge durch seine unverdünnten Substanzen verbrennt. Kaiser entdeckte bei weiterem Lesen, dass er seinen Kompost mit Kalzium (aus zerbrochenen Austernmuscheln) und Spurenelementen (aus gemahlenem Festgestein) neutralisieren konnte. Und so schichtete er die gesamte Masse auf den Boden und setzte die Pflanzen durch sie hindurch an.
Dank der Nährstoffbalance in seiner Erde bekamen Kaisers Sämlinge, die schon robust waren, einen zusätzlichen Vorsprung. „Unsere Ackerfrüchte überholen die Unkräuter von Anfang an“, sagt Kaiser. „Auf diese Weise brauchten wir nicht mehr Unkraut jäten“. John Cheatwood, einer von Kaisers Angestellten, drückt es so aus: „Der Kompost ist unsere Antwort auf Egge und Pflug“. Dieser hochintensive Zyklus — Kompost, Stecklinge setzen, Ernten, Wiederholen — erlaubt es Kaiser, bis zu sieben Mal pro Acre pro Jahr zu ernten. Das ist das Drei- bis Fünffache dessen, was die meisten Farmen erzeugen. Warum sollte man das nicht leben?!
Eine Frage des Maßstabs
Eines Morgens im Juli kamen zwei Besucher von Zentrum für Agroökologie und nachhaltige Ernährungssysteme der kalifornischen Universität Santa Cruz zur Singing-Frogs-Farm. Einer von ihnen war Jim Leap, der jahrzehntelang das Farm- und Gartenprogramm des Zentrums leitete. Es war in den 1960er-Jahren von Alan Chadwick angeschoben worden, dem legendären und quicklebendigen Paten der kalifornischen Bewegung für organische Landwirtschaft. Über die Jahre wurde der Universitätsgarten, der auf einem felsigen Hang blühte und gedieh, so legendär wie sein Gründer; legendär waren auch zahlreiche leider vergebliche Bemühungen, das Modell Chadwicks auf die große Agro-Industrie zu übertragen. Leap litt unter vielen dieser „romantischen“ Bemühungen und den damit verbundenen Erfahrungen — bis zu jenem Morgen.
Während Leap und sein Kollege Darryl Wong an Kaisers überbordenden Gemüsebeeten entlang gingen, zeigten sie sich inspiriert durch diese Masse an Innovationen. Die meisten Farmer bauen nur eine kleine Auswahl von Gemüsesorten an. Und einige, sogar solche, die „organische“ oder „nachhaltige“ Verfahren für sich beanspruchen, konzentrieren sich nur auf eine (üblicherweise Salat). Dieses Verfahren, „Mono-Cropping“ (Mono-Anbau) genannt, wird weithin kritisiert. Es laugt den Boden aus und reduziert die Vielfalt der wilden Lebewesen, die normalerweise auch auf einer Farm leben. Es schafft ein Vakuum, das bestimmte Schädlinge begünstigt. Im Gegensatz dazu zielt Kaiser auf Vielfalt, und das extrem. Auf nur acht Acres hat er Hunderte einheimischer Bäume und Büsche. Auf den zweieinhalb Acres davon, die er kultiviert, baut er eine entsprechende Zahl verschiedener Gemüsesorten an, darunter Brokkoli, Blumenkohl, Kohl, Paprika, Gurken, Winterkürbis, Kopfsalat und Sareptasenf — und diese in ungefähr sechs Varianten pro Sorte — dazu 30 bis 35 verschiedene Arten von Tomaten. „Niemand anders macht das“, sagte Leap mit verwunderter Miene.
Ein frisch bearbeitetes Feld war mit einer dicken, filzartigen Decke bedeckt — Kaisers Version der Meilen schwarzer Plastikfolien, die man sieht, wenn man im Winter durch amerikanisches Farmland fährt. Diese langen „Laken“ heißen „Plastik-Mulch“ und sie sind höchst wirksam — beim Unterdrücken von Unkräutern, beim Feuchthalten und beim Füttern der Bodenmikroben. Jedes Jahr landen diese schwarzen Plastikfolien auf Deponien. Kaiser zeigt auf seine Mulchdecken und sagt: „Die halten 10 Jahre. Wenn wir sie im Frühling aufrollen“ — und plötzlich fing Kaiser an, mit hoher Stimme zu singen: „Der Boden darunter ist soooooooooo wunderbar!“ Könnte die Agro-Industrie auch solche Mulchdecken verwenden? „Sicher“, sagte Leap. „Wenn sie sie zur Deponie bringen, können sie sie auch aufheben und zusammenlegen, um sie wieder zu verwenden.“ In einem von Kaisers Gewächshäusern entlockten Größe und gesundes Aussehen der Auberginen großes Erstaunen aller. „Ich habe noch nie solche Auberginen hier an der Küste gesehen“, sagte Leap. „Auberginen ziehen alle möglichen Schädlinge und Krankheiten an“. Sogar die unbearbeiteten Wege zwischen den Gemüsebeeten beeindruckten Leap und Wong. Üblicherweise sind diese kahl und hart; Kaisers Wege waren weich und grün. „Es macht solch einen Spaß zu sehen, wie all dies im kleinen Rahmen funktioniert“, sagte Leap, „weil Jedermann hofft, so etwas zu tun.“
Der Reichtum der Farm brachte Leap dazu, Kaiser mit der Frage zu nerven, die jeder stellen würde: „Ich bin mir nicht sicher, ob so etwas auch im großen Rahmen geht“, sagte er. Kaiser liebt diese Frage, denn sie ist entscheidend, aber er hasst die Art und Weise, mit der sie immer gestellt wird. „Ich dachte früher, die beste Weise, dies zu tun, sei eine riesengroße Farm mit einem Haufen Felder wie diesem hier rund um ein Zentrum zu haben“, antwortete Kaiser. „Aber mein Nachbar bepflanzt 44 Acres (knapp 18 Ha), produziert weniger als ich, verkauft bei weniger Regionalmärkten und hat weniger Vertragskunden. Darum brauchen wir keinen größeren Rahmen. Wir brauchen mehr kleine Farmen wie diese in städtischen Bereichen und weniger Riesenfarmen von 100 Acres, die weit, weit weg von den Menschen sind, die ihre Früchte essen.“
 Wenn Ihnen Kaisers Ziele zu idealistisch und romantisch erscheinen, so gibt es durchaus große Player in der Ernährungsindustrie, die das differenziert sehen. Miles Reiter, CEO (Chief Executive Officer = Geschäftsführer) von Driscoll’s, des größten Produzenten und Verarbeiters von Beerenfrüchten mit Sitz in Watsonville, kündigte öffentlich an, dass er eines Tages nicht mehr in der Lage sein werde, Beeren zu transportieren — einfach wegen der steigenden Kosten und der immer größeren Knappheit von Treibstoff. Bei der Abschlussveranstaltung des Weltkongresses zur nachhaltigen Landwirtschaft im vergangenen Jahr zeigte Dwayne Beck, Professor für Landwirtschaft der Universität Süd-Dakotas, auf, dass 80 Prozent der Kosten dessen, was Farmer auf ihre Felder ausbringen (Wasser, Spritzmittel, Dünger, Arbeiten) fossile Energien ausbeuten. „Vor 120 Jahren lag dieser Prozentsatz bei Null“, sagte Beck. „120 Jahre später wird diese Zahl wieder Null sein müssen“. Als Leap Kaisers Felder besuchte, die nur knapp oberhalb vom Zentrum Sebastopols liegen, musste er sich geradezu eine andere Zukunft vorstellen. „Wenn der Ölpreis mal so richtig steigt“, sagte er, „wird sich diese Methode wie ein Lauffeuer verbreiten“. Wong nickte ernsthaft: „Das muss sein“.
Wenn Ihnen Kaisers Ziele zu idealistisch und romantisch erscheinen, so gibt es durchaus große Player in der Ernährungsindustrie, die das differenziert sehen. Miles Reiter, CEO (Chief Executive Officer = Geschäftsführer) von Driscoll’s, des größten Produzenten und Verarbeiters von Beerenfrüchten mit Sitz in Watsonville, kündigte öffentlich an, dass er eines Tages nicht mehr in der Lage sein werde, Beeren zu transportieren — einfach wegen der steigenden Kosten und der immer größeren Knappheit von Treibstoff. Bei der Abschlussveranstaltung des Weltkongresses zur nachhaltigen Landwirtschaft im vergangenen Jahr zeigte Dwayne Beck, Professor für Landwirtschaft der Universität Süd-Dakotas, auf, dass 80 Prozent der Kosten dessen, was Farmer auf ihre Felder ausbringen (Wasser, Spritzmittel, Dünger, Arbeiten) fossile Energien ausbeuten. „Vor 120 Jahren lag dieser Prozentsatz bei Null“, sagte Beck. „120 Jahre später wird diese Zahl wieder Null sein müssen“. Als Leap Kaisers Felder besuchte, die nur knapp oberhalb vom Zentrum Sebastopols liegen, musste er sich geradezu eine andere Zukunft vorstellen. „Wenn der Ölpreis mal so richtig steigt“, sagte er, „wird sich diese Methode wie ein Lauffeuer verbreiten“. Wong nickte ernsthaft: „Das muss sein“.
Wenn dieser Tag jemals kommt, was dann genau eintritt, könnte die Anbaumethoden weltweit ändern. Wenn diese Änderungen sich verbreiten, werden ihre Macher sich, bewusst oder unbewusst, der Methoden Kaisers bedienen. Einige von ihnen werden auch jetzt angewendet mit überraschenden Erfolgen auf Getreidefeldern des Mittleren Westens — mit Innovationen, die unser gesamtes Handelssystem umwandeln könnten. (Siehe auch: “A Brand New Idea for Commodity Exports” = Eine brandneue Idee für Handelsexporte). Abgesehen davon ist es bei Ackerfrüchten wie Mais und Weizen relativ einfach, gesündere Methoden wie Direktsaat anzuwenden; Jedoch scheint diese Methode für Gemüsefelder im großen Stil wohl schwieriger. Dennoch sind einige wenige Menschen einigen vielversprechenden Lösungen auf der Spur. (Siehe: “Your Salad’s Difficulty with Sustainable Farming”=Die Probleme Ihres Salats mit nachhaltiger Landwirtschaft).
Im Laufe von Leaps und Wongs Spaziergang kamen weitere Gedanken auf. „Wir haben hier einen Überfluss-Markt. Könnte so etwas wie deine Farm in Modesto oder Fresno funktionieren?“, fragte Leap im Hinblick auf die Armut und die heißen klimatischen Bedingungen der Gegend. „Ich habe das bereits in Gambia gemacht“, erwiderte Kaiser, „am Rand der Sahara! Ich fände es toll, die Chance in Modesto dafür zu bekommen.
Könnte es wirklich so leicht sein? Lohnkosten in Kalifornien unterscheiden sich sehr von denen in Afrika. Und Kaiser s Lohnkosten sind noch höher — er braucht auf jedem Acre vier bis fünf Mal so viele Arbeiter wie ähnliche Farmen. Aber Kaiser ist stolz auf diesen Unterschied. Während die Arbeit auf den meisten Farmen Teilzeitarbeit ist und nur saisonbedingt, ist die Arbeit auf der Singing-Frogs-Farm Vollzeitarbeit über das ganze Jahr. Kaiser zahlt auch etwas höhere Löhne im Vergleich zur Norm wegen der höheren Fähigkeiten, die sein System erfordert — Bodenbedingungen erkennen können, die Methoden von Beet zu Beet anpassen können je nach den Bedürfnissen der Pflanzen auf dem Beet, und schnell arbeiten können. Aber er gibt kein Geld für Herbizide, Pestizide, tonnenweisen Dünger, Traktoren, Treibstoff und Maschinenunterhalt oder tägliche Bewässerung aus. Auf diese Weise, sagt er, steht er immer prima da. Das ist für Kaiser gut, aber ist es das auch für seine Arbeiter?
Kaisers ältere Arbeiter bekommen 15 $ pro Stunde. Das ist weit höher als die durchschnittlichen Löhne, die etwa bei Kaliforniens Mindestlohn von 9 $ die Stunde liegen — dennoch kann es in einer Gemeinde mit hohen Lebenshaltungskosten wie Sebastopol ziemlich eng mit solch einem Lohn werden. „Wenn die Menschen möchten, dass Farmarbeiter fair bezahlt werden“, sagt Marty Renner, Kaisers ältester Arbeiter, „werden sie auch viel mehr für ihre Lebensmittel bezahlen müssen“. (Wenn Sie mehr erfahren möchten, was das Leben in Sonoma bei einem Stundenlohn von 15 $ bedeutet, lesen Sie bitte Anmerkung 1 am Ende des Artikels)
Das Kompost-Rätsel
An einer Stelle während Leaps Gang über die Farm gruben wir alle unsere Hände in Kaisers Boden. Er roch sehr aromatisch und war überraschend leicht. „Er fühlt sich fast wie Blumenerde an“, sagte Leap, als er die Erde durch seine Finger rinnen ließ. Das lag teilweise an der Jahreszeit (Die Sommerhitze trocknet den Boden aus.) Aber der Hauptgrund war, dass sie fast ganz aus Kompost bestand, der sehr locker beim Trocknen wird. All dieser Kompost war Leap unheimlich. „Er braucht weit mehr davon als sonst üblich“.
Kompost ist eine komplizierte Angelegenheit. Einerseits regen seine reichen Inhaltsstoffe das Pflanzenwachstum so wirksam an, dass man sich wundert, warum nicht mehr Farmer davon Gebrauch machen. „Wir haben einfach nicht den Kohlenstoff“, sagt Ray Archuleta von der USDA. Archuleta bezieht sich auf die Lücke zwischen verfügbaren Kompostvorräten und die 920 Millionen Acres (=3.723.108 km²), die gegenwärtig in diesem Land beackert werden; Aber er meint das Wort „Kohlenstoff“ auch provokativ. Kohlenstoff ist schlecht, nicht wahr? Wenn er sich in Kohlendioxid verwandelt, trägt er hauptsächlich zur Klimaerwärmung bei. (Dasselbe geschieht mit Stickstoff, wenn es sich in Stickstoffoxid verwandelt, ein Klimagas, das 300 Mal wirksamer ist als Co2.) Nun, Kohlenstoff und Stickstoff sind auch die Hauptbestandteile von Kompost und nach und nach der fruchtbaren Anteile der Bodenkrume. Das bedeutet, dass diese Chemikalien nur dann schädlich sind, wenn wir sie falsch einsetzen — in unserer Luft, wenn sie besser im Boden aufgehoben wären. Kaiser drückt es so aus: Was ich als Farmer am meisten brauche, ist Kohlenstoff für die Bodenstruktur und Strickstoff für das Pflanzenwachstum“.
Andererseits hat Kompost auch seine hässlichen Seiten. Weil weltweit immer mehr amerikanische Erntefrüchte verlangt werden, sind Farmer überall von Stickstoff abhängig geworden. Wenn ein Feld zu viel Stickstoff enthält, sickert er ins Grundwasser. An dieser Stelle sagt Leap: „Jede wasserführende Schicht unterhalb von landwirtschaftlich genutzten Flächen ist mit Nitrat verseucht“. (Wenn Nitrat sich in Nitrit verwandelt, ersetzt es den Sauerstoff im Blut seiner Konsumenten. In der Mitte des vergangenen Jahrhunderts waren einige Grundwasserquellen so sehr mit Nitrat verseucht worden, dass dies zum „Blue-Baby-Syndrom“ mit einigen Dutzend Todesfällen führte. Das Problem ist seitdem fast verschwunden, aber Agronomen haben sich bis heute Sorgen darum gemacht.) Die meisten Verseuchungen durch Nitrat geschehen bei sintflutartigen Regenfällen, die auf Mastanlagen und industrielle Farmen treffen, die unwahrscheinliche Mengen an synthetischen Stickstoffdüngern einsetzen. Viel jedoch kommt auch von einfachem Kompost, der üblicherweise viel Stickstoff enthält.
Seltsamerweise gehören Farmer, die Kompost lieben, zu den übelsten Stickstoffverseuchern. Und Leap fürchtet, dass Kaiser ein besonders herausragender Umweltsünder ist. Über die letzten paar Jahre hat Kaiser mehr als 60 Tonnen besonders stickstoffhaltigen Kompost auf jeden Acre seiner Farm ausgebracht — fünf bis zehn Mal so viel wie üblich. Vor jeder Pflanzung unterstützt er die Böden auch durch eine geringe Menge organischen Dünger, der besonders viel Stickstoff und auch Phosphor enthält — ein weiterer problematischer Nährstoff.

[Fotounterschrift] Kaiser düngt seine Ackerflächen mit ungewöhnlich großen Mengen Kompost — mehr als 60 Tonnen pro Acre im Jahr — den seine Arbeiter vor jeder Pflanzung mit Schubkarren aufbringen. Das sind 5–10 Mal mehr Kompost , als die meisten Farmer anwenden. Kaiser baut mehr Früchte an als der durchschnittliche Farmer, aber jüngste Tests zeigen an, dass sein Kompost mehr Nährstoffe aufbringen könnte, als die Pflanzen benötigen. Bei Überschüssen einiger solcher Nährstoffe — hauptsächliche Stickstoff, Phosphor und einige Spurenmetalle — werden sie giftig sowohl für Wasservorräte und auch für Konsumenten seiner Ackerfrüchte. Es ist daher wichtig für Kaiser und seine Nachahmer, genauere Messmethoden für den Nährstoffgehalt von Feldern zu entwickeln.
„Das ist ein Präzedenzfall“, sagt Leap. „Das ist eine riesengroße Über-Anwendung. Falls Paul zertifizierter Biofarmer werden wollte, könnte das Ärger geben“. Erstaunlicherweise ist Kaisers Farm das nicht – er widersteht diesem Label wegen der Kosten, des komplizierten Verfahrens und der Standards, die er oberflächlich findet. Ebenfalls erstaunlich ist, dass das seinen Kunden nichts ausmacht. Bei Befragungen befürworteten quasi alle seine unkonventionellen Anbaumethoden. Robin Boyle, Marketingdirektorin von California Certified Organic Farmers, sagt jedoch, dass im Fall einer Beantragung des Labels Kaisers seine Kompostmengen „sämtliche rote Lampen in unserem Büro angehen lassen würden“. Aber sie sagte auch, dass solche gewaltigen Mengen durchaus auch im Rahmen des Erlaubten sein könnten, je nach der individuellen Situation der Farm.
Kaiser argumentiert, dass die Situation seiner Farm klar innerhalb der erlaubten Grenzen ist — aus vier Gründen. Erstens sei der zusätzliche Stickstoff notwendig, weil er so sehr viel mehr Ackerfrüchte pro Acre anbaut als eine Durchschnittsfarm. Zweitens zeigten Bodenproben, dass dessen Stickstoffgehalt „genau dort ist, wo er sein sollte für gesunde Pflanzen“. Drittens bemerkt er, dass die Pflanzen den Stickstoff wirklich „aufessen“: Manchmal werden die Blätter gelb (was ein Zeichen für Stickstoffmangel ist). Und viertens fügt er hinzu, dass seine Teiche, die das auffangen, was vom Farmboden abfließt, sichtbar klar und voller Leben sind. Außerdem ergaben kürzliche Regenwassertest auch absolute Sauberkeit. (Durch Stickstoff oder Phosphor belastetes Wasser ist normalerweise durch Algen verstopft, die Fische und andere Wasserlebewesen töten, indem sie ihnen den Sauerstoff nehmen. Mit diesem Problem hatte Kaiser im ersten Jahr zu kämpfen, nachdem er besonders viel Kompost aufgebracht hatte, aber danach trat es nicht mehr auf.) „Alle unsere Felder und Anzeigegeräte zeigen, dass unser Stickstoffgehalt in Ordnung oder nicht hoch genug ist“, sagt Kaiser.
Hier könnte Kaisers Behauptung übertrieben sein. Die sichtbaren Zeichen lassen vermuten, dass seine Pflanzen alles konsumieren, das er ihnen gibt, aber wenn es um seine Boden- und Wassertests geht, ergibt sich beträchtlich mehr, als das Auge erkennen kann. Das wirkliche Bild gleicht einem Puzzle, aber es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen, um wenigstens die vielfältigen Aspekte zu beachten — und wenn es nur dazu dient, mögliche Nachahmer darauf hinzuweisen, was dazu gehört, eine solch ambitionierte Form der Landwirtschaft zu beherrschen wie Kaiser.
 Zunächst weisen Kaisers Bodenproben leicht erhöhten Nitratgehalt und einen noch etwas höheren Phosphorgehalt auf. Aber seine Regenwasserproben — die Agronome als den goldenen Weg ansehen, um Düngeleckagen einer Farm festzustellen — sind immer kristallklar.
Zunächst weisen Kaisers Bodenproben leicht erhöhten Nitratgehalt und einen noch etwas höheren Phosphorgehalt auf. Aber seine Regenwasserproben — die Agronome als den goldenen Weg ansehen, um Düngeleckagen einer Farm festzustellen — sind immer kristallklar.
Wie kann das sein? Wenn man Agronomen und Bodenwissenschaftlern zuhört, die Kaisers Methoden gegenüber skeptisch sind, verstecken sich diese Verschmutzer. Es könnte stimmen, aber genauso gut das Gegenteil. Wenn Sie den genauen Zahlen dieses Puzzles nicht widerstehen können — und die Debatte, die sie auslöste — lesen Sie bitte Anmerkung #2 am Ende des Artikels.
Glaubt man Kaiser, verfehlen die Labortechniker das richtige Ergebnis. Die Verschmutzer sind nicht sichtbar, einfach weil alles biologische Leben, das er in seinen Feldern aufgebaut hat, sie aufisst. „Die hochorganische Biomasse puffert jedes Ungleichgewicht in jenen Nährstoffen ab“, sagt Kaiser. „Mir scheint, dass all diese Kritik von Menschen geäußert wird, die ein wirklich biologisches System nicht verstehen“. Diese Behauptung ist kühn, aber Kaiser hat auch einige Wissenschaftler auf seiner Seite. „All das mikrobielle Leben geht durch einen Kreislauf dieser Nährstoffe“, sagt Jerry Hatfield von der USDA. Ray Ward, ein führender Experte für Bodenproben, stimmt zu. (Ward unterhält die Ward-Labore in Kearny, Nebraska, die einige von Amerikas umfassendsten Testverfahren für Nährstoffgehalte und mikrobielles Leben in Böden entwickelt haben. Kaisers letzte Tests wurden durch die Ward-Labore durchgeführt.) Jeff Creque, oberster Wissenschaftler beim Marin Carbon Project, steht auch zu Kaisers Methoden. Creque fügt an, dass die industrielle Landwirtschaft sich von biologischen System verabschiedet hat, was in erster Linie zur Verschmutzung durch Kohlendioxid geführt hat. „In früheren Zeiten konnte man den Stickstoffgehalt im Boden nur in Verbindung mit Kohlenstoff anheben“, sagt Creque. Heute füttern wir die Chemie des Bodens, anstatt die Biologie des Bodens zu nähren. Zudem verbrennen wir die Kohle“.
Das Problem ist, dass, egal wie qualifiziert diese Beobachter sind, sie letztendlich nur Vermutungen anstellen. Stickstoff und Phosphor sind nur zwei von Milliarden natürlichen und lebenden Bestandteilen, die so etwas wie einen Boden ausmachen. Wissenschaftler haben erst kürzlich angefangen zu verstehen, wie dieses Ökosystem Fruchtbarkeit beeinflusst, während seine winzigen Bewohner miteinander agieren. Einige solcher Interaktionen könnten die Entschuldigung für Kaisers Exzesse sein, andere können sie verschlimmern. „Wir wissen vielleicht weniger über den Boden, als wir über den Mond wissen“, sagt Morris.
In den Monaten nach seinem Besuch diskutierte Leap diese Fragen — mit sich selbst, mit Kaiser, mit vielen seiner Kollegen in der organischen Landwirtschaft und mit mir. Lange E‑Mails gingen hin und her, alle voller endloser Fragen und endloser Zahlenreihen. In Zuge dieses Prozesses mutete ich den beiden und vielen anderen, die sich der nachhaltigen Landwirtschaft widmen, so viele spitzfindige Befragungen zu, dass ich Hemmungen hatte, sie wieder anzusprechen. Die zentrale Frage, die diese Befragungen befeuerte, war grundsätzlich und fast unlösbar: Wenn Kaisers Methoden wirklich fehlerhaft sind, kann man sie korrigieren?
Anfangs war Leap ziemlich pessimistisch. „Ich bin nicht sicher, ob er auf dem jetzigen Niveau ohne diese Exzesse produzieren kann“, sagt mir Leap. Ich fürchte, sie sind untrennbar mit seinem System verbunden. Es ist, als würde das Gemüse durch den Kompost aufgepumpt“. Als ich Tim Hartz, einen anerkannten Professor der Pflanzenwissenschaften der kalifornischen Universität Davis, fragte, ob er Kaisers System für nachhaltig hält, war seine Antwort ein knappes Nein. All das hat Leap zunehmend Sorgen bereitet angesichts Kaisers extrem ökologischer Behauptungen. „Was mich stört“, sagte Leap, „ist, dass Paul solch eine große Angelegenheit aus diesem Keilschwanz-Regenpfeifer macht, weswegen er nicht mehr pflügt. Aber so sieht er es eben. Was er nicht sehen kann, sind die Folgen für die Fische flussabwärts von seiner Farm“.
Um fair zu sein, muss man sagen, dass Kaiser stufenweise seine Kompostmengen reduziert hat teilweise wegen des Sturms der Befürchtungen von außerhalb, was Leap wiederum optimistisch stimmt. Aber immer noch verwendet Kaiser weitaus mehr Kompost als unter Farmern im Allgemeinen bekannt ist. Und wenn Kaiser feststellt, dass er seine Verfahren nicht wesentlich ändern kann, wenn er bei seiner Version organischer Landwirtschaft bleiben will und seiner Produktivität –– was dann? Es bleibt ein zweischneidiges Schwert: wichtige Nahrung für den Boden einerseits und Nahrungsverschmutzung (durch Auswaschung von Stickstoff, Phosphor etc.) andererseits.
Was auch bedeutsam ist für einige Menschen: Bei der kommerziellen Produktion von Kompost werden tonnenweise fossile Brennstoffe verbrannt. Kaiser selbst kann nur etwa ein Drittel des Komposts, den er für seine Farm braucht, selbst produzieren. Der Rest kommt von seinen Nachbarn im Sonoma County. Wenn Essensreste und Gartenabfälle zur örtlichen Deponie gebracht werden, durchlaufen sie in dieselbetriebenen Anlagen 15 verschiedene Phasen des Trennens, der Reinigung, des Zerkleinerns und der Belüftung, um zu neuem Boden zu werden –– der dann mit einer Rate von 150 Tonnen pro Tag die Deponie verlässt. Und auch dieses Endprodukt ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Ich bemerkte dies eines Morgens, als ich Kaisers Team beim Pflanzen von Gurken half. In fast jedem Loch fand ich einen oder zwei kleine Schnipsel Plastik, Alufolie oder andere Materialien, die sich nicht zersetzen. Das ist all jenen Nachbarn geschuldet, die nach nahezu zwei Jahrzehnten voller Öffentlichkeitskampagnen immer noch nicht richtig Müll trennen können.

Obwohl der Kompost, den Kaiser kauft, eine ungewöhnlich hohe Qualität hat, finden sich doch immer wieder Abfallreste darin wie dieser Rest einer Plastiktüte. Bis die Bürger gelernt haben, was Abfall ist und was nicht, werden diese Stückchen weiterhin unvermeidbar sein. Sie sehen zwar nicht schön aus, sind aber harmlos, denn sie werden weder von der Erde noch von den Pflanzen aufgenommen.
Darum sieht Leap ein System, das von so viel Kompost abhängt, sehr skeptisch. „Wenn die Bodenmikroben ihre Arbeit verrichten“, sagte Leap mir, „braucht man nicht zusätzlich Stickstoff zusetzen.“ Andere bevorzugen eher Kaisers Antwort: „Wo soll denn all unser Biomüll hin?“, fragt er. „Es gibt nur zwei Möglichkeiten — versenkt man ihn im Meer, führt er zu exzessivem Pflanzenwachstum, das Meereslebewesen den Sauerstoff wegnimmt. Oder man bringt ihn auf die Deponien“. Mit anderen Worten: Vielleicht ist die menschliche Evolution selbst der letzte Kompromiss unseres Planeten. Alles Leben bedeutet Energie, in der einen oder anderen Form. Und der Abfall dieser Energie muss irgendwo hin. Es gibt kein organisches Mittagessen ohne Kompromiss.
Nachhaltigkeit angesichts der Städte von Morgen
 Nach einigen neuen Zählungen produzieren die Amerikaner so viel kompostierbaren Abfall und nutzen so wenig davon, dass in Kalifornien wenigstens 15 Millionen Tonnen dieses reichhaltigen Materials (ist es erst mal trocken) und mehr als 200 Millionen Tonnen landesweit jedes Jahr auf Deponien landen. Vorrangig produziert es dort Methan, das besonders zur Klimaerwärmung beiträgt.
Nach einigen neuen Zählungen produzieren die Amerikaner so viel kompostierbaren Abfall und nutzen so wenig davon, dass in Kalifornien wenigstens 15 Millionen Tonnen dieses reichhaltigen Materials (ist es erst mal trocken) und mehr als 200 Millionen Tonnen landesweit jedes Jahr auf Deponien landen. Vorrangig produziert es dort Methan, das besonders zur Klimaerwärmung beiträgt.
Auf einem Acker erzeugt Kompost jedoch neben Pflanzen eine Menge guter Dinge. Landwirte nennen es „Organisches Bodenmaterial“ oder „SOM“ (soil organic matter) und es ist hauptsächlich zuständig für die Fruchtbarkeit des Bodens. SOM ist im Wesentlich alles Restgewebe, egal ob lebend oder nicht, aller lebenden Organismen — Pflanzen, Wurzeln, Käfer, Mikroorganismen, Pilze, Schwämme, Flechten, was auch immer. All dieses Verrotten ist wunderbar effektiv. Es hilft dem Boden, das Wasser zu halten. Was noch wichtiger ist: Wenn Wasser knapp ist, nährt all dieses verrottende Material die Wurzeln der Pflanzen und die Mikroorganismen um sie herum, sodass die Pflanzen weiter wachsen können. Dwayne Beck beschreibt es so: „SOM ist das Lebendige, das Tote und das sehr Tote. Wenn man schlechten Boden beackert, benutzt man das sehr Tote. Wenn man gut ackert, verwendet man das Tote. Das Lebendige aber ist das, was man nutzen möchte“. Lebendig oder tot, SOM besteht immerhin zu 60 Prozent aus Kohlenstoff. Und je mehr davon im Boden ist, desto weniger davon geht in die Luft über, wo es Kohlendioxid produzieren würde.
1920, vor dem Entstehen der industriellen Landwirtschaft, machte SOM durchschnittlich zwischen 6 und 8 Prozent unserer Bodenkrume aus. Über die Jahre, in denen amerikanische Farmer ein System anwendeten, das mehr extrahierte als hinzufügte, sank das Niveau des SOM durchschnittlich auf 2 Prozent, in einigen Gebieten sogar unter 1 Prozent — was mehr als die Hälfte der Mindestmenge für einen gesunden Boden bedeutet. Eine einfache Maschine, die allgegenwärtig wurde, verursachte diesen Verlust: der Streichbrettpflug (moldboard plow) (erfunden — wer hätte es gedacht? — von Thomas Jefferson). In einem Bericht der Universität von Minnesota im Jahr 2002 heißt es: „Je tiefer und aggressiver das Pflügen erfolgt, desto mehr CO2 geht in die Atmosphäre über“. Und der Streichbrettpflug, so die Autoren des Berichts, sei „das aggressivste Gerät, das je verwendet worden ist“.
Als die Kaisers die Singing-Frogs-Farm kauften, war deren Boden fünf Jahre lang nicht gepflügt oder bepflanzt worden, weswegen er relativ gesund war: SOM wurde mit 2,4 Prozent getestet (nicht schlecht für den sandigen Lehm, der typisch für diese Gegend ist). Nachdem Kaiser sein kompostbasiertes System in die Tat umsetzte, stieg der SOM-Grad der Farm bis auf 10 Prozent an. Dieses Niveau wäre sogar noch höher, wenn man die Bodenproben aus höheren Schichten nähme. Versuche in diesem Herbst zeigten, dass sein Boden auch besonders reich an Mikroben war, sowohl mengenmäßig als auch, was die Vielfalt betrifft. Dieses verborgene Material könnte ein Grund dafür sein, warum Kaisers Felder so üppig waren trotz der Dürre. Immer wieder weist er darauf hin, dass jedes Prozent mehr auf einem Acre Land bedeutet, dass die oberste Bodenschicht von 30 cm zusätzlich 4360 Liter Wasser halten kann.
Diese 4360 Liter präsentierte Kaiser seinen Zuhörern bei der Landwirtschaftskonferenz in Napa, wo ich ihn zum ersten Mal traf. Das zentrale Thema dieser Konferenz war die Erhaltung von landwirtschaftlichen Böden und zahlreiche Referenten stellten die verschiedenen Maßnahmen vor, die eine Handvoll kalifornischer Landkreise (Counties) gerade treffen, um zu vermeiden, dass Städte sich immer mehr ausbreiten und dabei immer mehr Landwirtschaftsfläche schlucken. Trotz solcher Initiativen ist der allgemeine Trend hier eher schwach. Seit 1982 haben die USA 13 Millionen Acre (=52.610 km²) erstklassiges Farmland der städtischen Entwicklung opfern müssen.
Diese Zahlen schmerzen besonders, wenn man an Kaisers Langzeit-Hoffnung denkt: ein Netzwerk kleiner Farmen in den Weltstädten, die uns gegen Treibstoff- und Wasserknappheit in der Zukunft schützen könnten. Wenn seine Vision überhaupt eine Chance bekommen soll, müssen wir unsere Städte vollkommen anders strukturieren. „Die meisten Städte befinden sich in der Mitte besten Farmlands“, sagte Ed Thompson vom American Farmland Trust den Zuhörern der Napa-Konferenz, „weil der Ursprung aller Städte landwirtschaftliche Regionalmärkte waren“.
Das Geschenk der Dürre
An einem frostigen Morgen im letzten Januar saß ich an einem Picknick-Tisch, von dem aus ich die Felder der Singing-Frogs-Farm sehen konnte, während Kaiser und seine Frau, eingehüllt in Fleece-Jacken, mir ihre Geschichte erzählten. Die ersten Zeichen einer erneuten Dürre kündigten sich an und ich fragte sie, ob sie besorgt seien. „Mit den Pflanzen wird alles in Ordnung sein“, sagte Kaiser schulterzuckend. „Mir machen eher die Bäume Sorgen“. Kaiser traut seinen Pflanzen einiges zu, weil er sie nicht mit Sprühungen und Dünger schwächt. Das kräftigt sie und sie können ihre eigenen Polyphenole entwickeln — das ist der Kern des pflanzlichen Immunsystems. Es scheint, dass Pflanzen nach demselben Grundsatz funktionieren wie die Menschen: was nicht gebraucht wird, verschwindet. „Wenn wir all den Schutz für sie übernehmen“, sagte Kaiser, „werden sie sich nicht mehr selbst verteidigen“. Plötzlich machte Elisabeth Paul auf einen gebrochenen Schlauch aufmerksam, aus dem eine Wasserfontäne hochsprang. Kaiser stöhnte und drehte einen Anschluss entsprechend ab. „Ich habe diese Fröste echt satt“, sagte er, als er wieder zurückkam.

[Fotounterschrift] Kaiser beschleunigt seine Produktion, indem er seine Sämlinge päppelt und sie erst richtig anwachsen lässt, bevor er sie auf die Felder pflanzt. Viele anderen Farmer tun das auch, aber Kaisers Weg unterscheidet sich zweifach: Erstens pflanzt er seine Saaten in Kompost. Die meisten Farmer fürchten mögliches Krankheitspotenzial im Kompost und benutzen stattdessen sterile Gartenerde. Diese ist zwar sicher, aber auch nicht sehr nährstoffreich, was die Pflanzen schwächt und für weniger Nährstoffe in den reifen Früchten sorgt. Zweitens verpflanzen die meisten Farmer, um den Platz maximal auszunutzen, ihre Sämlinge schon, wenn sie noch relativ klein und erst zwei Wochen alt sind. Kaiser verwendet größere Container, damit seine Sämlinge einen ganzen Monat bis zum Versetzen wachsen können. Das beschleunigt nicht nur ihren Start, sondern erhöht auch ihre Überlebensrate auf dem Feld.
In den letzten paar Wochen schwankten die Temperaturen jeden Tag um bis zu 10 Grad, weswegen die örtlichen Zeitungen von wüstenartig sprachen. „In den letzten zwei Jahren fiel der letzte Regen am 1. Februar“, sagte Kaiser, „und es sieht dieses Jahr wieder danach aus.“ Nicht nur fällt wenig Regen, es gibt auch Frostphasen — der erste Frost schlägt auf Kaisers Farm typischerweise Ende September zu, der letzte Mai. „Wir haben Temperaturen von wenigstens ‑7° C vier Wochen lang jedes Jahr“, sagte Kaiser. Der Grund: Singing Frogs befindet sich am Tiefpunkt eines flachen Tales, wo die Temperaturen im Schnitt 5 Grad niedriger sind als im Durchschnitt als bei den Nachbarn, die nur wenige hundert Meter weiter bergauf leben. An jenem Morgen sahen Kaisers Ackerfrüchte entmutigter aus, als er selbst war — viele waren verwelkt oder tot. Fresslustige Fliegen summten überall herum.
Als ich mit Kaiser Monate später wieder sprach, war er wieder voller Energie. Trotz der Dürre erntete er reichlich und seine Einnahmen waren da schon höher als zum selben Zeitpunkt im Jahr zuvor. Das lag zum Teil daran, dass er weniger Konkurrenz auf dem regionalen Bauernmarkt hatte. Viele Nachbarfarmen hatten schwer in dem harten, trockenen Winter gelitten. Einer kaufte sein Gemüse von der Singing Frogs Farm. Aber auch Kaisers eigene Kunden waren wohlversorgt. „Beim Regionalmarkt“, sagte Kaiser, „kamen tatsächlich Leute zu mir und fragten: „Bekommt Ihr Blumenkohl Drogen?“
Anmerkung #1
Die Wirklichkeitswelt der Arbeit
Mit Landwirtschaft Geld zu verdienen war immer schon sehr hart. Wenn das nicht stimmte, hätte es nicht diese weltweiten Wanderungsbewegungen vom Land in die Städte seit dem Beginn der Zivilisation gegeben. In den letzten Jahren jedoch hat die Landwirtschaft so etwas wie einen romantischen Glanz bekommen (zumindest in den USA), was teilweise der wachsenden Beliebtheit der Regional- bzw. der Von-der-Farm-auf-den-Tisch-Bewegung und ihrem Widerhall in entsprechenden Lifestyle-Veröffentlichungen geschuldet ist. Der Alltag dieses „Lifestyle“ ist jedoch ein bisschen komplexer.
Kaisers langjährigster Arbeiter ist ein junger drahtiger Mann namens Marty Renner, der einen Bachelor und Master in Geschichte und einen Doktorgrad in Ernährungswissenschaft hat mit dem Fokus auf die Beziehung zwischen Boden und Zahngesundheit. Diese Abschlüsse und Referenzen zusammen mit vier Jahren Erfahrung auf der Singing-Frogs-Farm „erhöhen“ seinen Wert auf einen Stundenlohn von 15 $ ohne weitere Zuschläge.
Das ist mehr, als die meisten Farmen bezahlen (Farmarbeiter bekommen üblicherweise eine Art Mindestlohn, der in Kalifornien gegenwärtig bei 9 $ steht). Dennoch findet Renner, dass sein Lohn in einer so teuren Gegend wie Sebastopol nicht sehr hoch ist. „Wenn man nicht ohnehin schon Geld und Land hat, kann man sich mit solch einem Lohn kein Leben im Mittelklassenbereich leisten.“ Um die Miete im Sonoma County stemmen zu können, nahm Renners Frau eine Arbeit in San Francisco an, das eine Stunde entfernt ist. Eine Zeitlang lebte das Paar in einer Hütte auf einem Stückchen Land, das Renners Eltern gekauft hatten. Aber die Abzahlungen waren so hoch, dass Renners Vater das junge Paar irgendwann vor die Tür setzen musste, um selbst da wohnen zu können. Inzwischen verdient John Cheatwood, Renners Kollege, genauso viel und es geht ihm gut damit.. Er und seine Frau, die auch arbeiten geht, konnten ihren Studienkredit von 42.000 $ innerhalb von drei Jahren abbezahlen.
Wenn man sich ein bisschen näher damit befasst, wird das Bild interessanter. Beide Paare sind jung, beide erwarten ihre ersten Kinder innerhalb von Monaten. Ihre Lebensumstände machen also einen fairen Eindruck.
Cheatwood macht sich jedenfalls keine Sorgen. „Jetzt gerade sind wir in einer Tretmühle“, sagt er. „Es geht nicht vorwärts, aber auch nicht rückwärts“. Cheatwood sagt, dass ihr doppeltes Einkommen dafür sorgt, dass sie ihre Rechnungen bezahlen können, dazu auch die Versicherungspolicen und sich eine gelegentliche Reise mit dem Auto oder eine Abendveranstaltung leisten können. Für diesen Mann reicht das aus. „Wir sehen uns eher in der Arbeiterklasse als in der Mittelklasse“, sagt er ohne jede Bitterkeit. Renner jedoch verfolgt größere Ziele. Er hat zwei Nebenjobs — in dem einen zieht er 300 Hühner auf seines Vaters Eigentum auf, in dem anderen unterrichtet er Geschichte an der kalifornischen Universität Berkeley, mit dem er sich den lang gehegten Traum des Lehrerberufs erfüllt. Diese Mischung an Verpflichtungen erschöpft ihn sehr. „In einem guten Teil meiner Freizeit muss ich mich einfach körperlich erholen“, sagte er mir. „Wenn meine Frau mit mir kochen oder spazieren gehen möchte, muss ich sagen: ‚Nein, ich muss mich ein paar Tage einfach nur ausruhen’“ Kurz gesagt, Kaisers wirtschaftliche Struktur mag die täglichen Bedürfnisse seiner Angestellten zufriedenstellen, aber sie scheint nicht stark genug zu sein, ihnen eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Marty Bennett, emeritierter Professor für Laborgeschichte am benachbarten Santa Rosa Junior College, macht sich Sorgen darüber. „15 $ pro Stunde ohne Zuschläge sind entscheidend unterhalb des aktuellen Existenzminimums“, sagt er. Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten Farmer selten Menschen wie Renner und Cheatwood einstellen — ausgebildete weiße Männer mit vergleichsweise vielen Möglichkeiten. Oder wenigstens nicht auf lange Zeit. (Das vorherrschende Zauberwort in der Welt organischer Landwirtschaft lautet „WWOFer“, ein Begriff, der zugleich Unregelmäßigkeit und Unzuverlässigkeit bedeutet. WWOFer sind Menschen, die gegen Unterkunft und Verpflegung und Vor-Ort-Ausbildung und sonst ohne Lohn auf organischen Farmen arbeiten möchten (WWOF = Willing to Work on Organic Farms). Mit der Zeit ringt sich jede erfolgreiche Farm dazu durch, eine professionelle Mannschaft von Latinos anzuheuern“.
Anmerkung #2
Der unsichtbare Tanz der Bodenchemie
 In einer Reihe von Bodentests über die letzten zwei Jahre wiesen Kaisers Felder durchschnittlich 50 ppm (parts per million) Nitrat auf — doppelt so viel wie die Norm von 25 ppm. Seine Phosphatmengen sind noch höher — eine Messung betrug 247 ppm. Das ist ungefähr das Fünffache dessen, was als ökologisch von den Ward-Laboren in Nebraska bezeichnet wird. (Zu den Ward-Laboren siehe weiter oben) „Ich würde sagen, dass das viel zu viel ist“, sagt Direktor Ray Ward angesichts des Phosphatgehalts.
In einer Reihe von Bodentests über die letzten zwei Jahre wiesen Kaisers Felder durchschnittlich 50 ppm (parts per million) Nitrat auf — doppelt so viel wie die Norm von 25 ppm. Seine Phosphatmengen sind noch höher — eine Messung betrug 247 ppm. Das ist ungefähr das Fünffache dessen, was als ökologisch von den Ward-Laboren in Nebraska bezeichnet wird. (Zu den Ward-Laboren siehe weiter oben) „Ich würde sagen, dass das viel zu viel ist“, sagt Direktor Ray Ward angesichts des Phosphatgehalts.
Was einigen Bodenwissenschaftler wirklich Sorgen bereitet, mit denen ich sprach: Nach den Standards für Bodenproben sollen der oberen Bodenschicht von 15 cm entnommen werden, um sich darauf zu konzentrieren, wo wachstumsfördernde Elemente am intensivsten sein sollen. In einigen Direktsaatsystemen werden diese Proben nur aus einer Schicht von 0 bis 10 cm entnommen, weil man allgemein glaubt, dass ohne Bodenbearbeitung mit Pflug oder Egge die Nährstoffe unvermischt bleiben und auf diese Weise dichter an der Oberfläche. Kaiser jedoch glaubt, da sein Boden so nährstoffgesättigt ist, dass sein Profil tiefer gehen muss und dass auch die Wurzeln seiner Ackerfrüchte dies ausdrücken. Darum testet er generell in einer Tiefe von 23 bis 30 cm.
Welchen Unterschied macht das? „Ich weiß noch nicht einmal, wie ich das interpretieren soll“, sagte mir Thomas F. Morris, Professor für Pflanzenwissenschaften der Universität von Connecticut, der sich auf Bodenfruchtbarkeit spezialisiert hat. Eine Probe ist bedeutungslos, wenn sie nicht in der vorgeschriebenen Tiefe vorgenommen wird. Wenn er in 23 bis 30 cm Tiefe misst, bedeutet dies, dass bei 15 cm Tiefe sein Nährstoffgehalt zwei bis vier Mal höher ist. Sein Phosphor betrüge vielleicht sogar 500 bis 700 ppm, wenn er ordentlich mäße“. Das bedeutet: Das Phosphat in Kaisers Feldern könnte 10 Mal höher sein, als es sein müsste, um das Grundwasser sauber zu halten.
Aber warum schlagen sich diese hohen Werte nicht in Kaisers Teichen nieder? Die Antwort ist der Schlussbaustein in Kaisers Nitrat-Phosphat-Puzzle — wenigstens fürs erste. Wissenschaftler sagen, dass sowohl Nitrat als auch Phosphat sich im Boden verstecken. Nitrat kann von Bodenmikroben verschluckt werden und wird nur sichtbar, wenn diese sich entleeren oder sterben. Phosphor versteckt sich anders — er klebt an Erdpartikeln und setzt sich über einen Zeitraum von Jahrzehnten frei, wenn er sich in Regenwasser löst. Manchmal entwischen diese Nährstoffe und Dutzende anderer, die gegenwärtig messbar sein können, allen Tests. Diese letztgenannte Möglichkeit kommt in Frage, weil Kaiser seine Bodenproben in größerer Tiefe als die meisten anderen vornimmt — bei 23 bis 30 cm. Bodenlabore verlangen generell, dass die Proben aus einer Tiefe von 0 bis 15 cm entnommen werden, weil in dieser Schicht die Nährstoffe am konzentriertesten sind. Kaiser kümmert sich nicht um solche Vorschriften, weil er glaubt, dass sie nicht die Tiefe seines Bodenreichtums berücksichtigen. Dies nervt die akademischen Experten sehr. „Diese Daten sind wertlos“, sagt Tim Hartz, ein anerkannter Agronom der kalifornischen Universität Davis. Thomas Morris, Connecticut, pflichtet ihm bei: „Ich brauche wirkliche Zahlen“, sagt er. „Ich brauche einen Bodentest, der den Richtlinien folgt. Er [Kaiser, Anm.] versteht das System nicht, Er geht blind vor“. Morris ist sich sicher: „Sein System ist lückenhaft. Wenn er das weitere sieben Jahre beibehält, wird es mit 99%iger Sicherheit zu einer Umweltkatastrophe kommen“.
Ray Ward hat jedoch eine ganz andere Ansicht. Nach Überprüfung von Kaisers Boden- und Wasserproben und unter Berücksichtigung des vollen Ausmaßen von Kaisers Arbeiten kam Ward der Verdacht, dass seine Kritiker Unrecht haben könnten. Was ihn darauf brachte, waren nur zwei Proben, die im selben Loch in zwei unterschiedlichen Tiefen gezogen worden waren. Der Test zeigte, dass beide Proben den gleichen Nährstoffgehalt aufwiesen. Da dieser Test in seiner Art einzigartig war — und noch dazu allem widerspricht, was die meisten traditionellen Agronomen und Bodenwissenschaftler über das Wirken der Fruchtbarmachung wissen — waren die meisten geneigt, ihm keine Beachtung zu schenken. Und doch gleicht er einigen interessanten neuen Studien, die Ward in Nebraska beobachtete. Diese Studien verglichen maschinell bearbeitete Felder mit solchen, die überhaupt nicht bearbeitet werden. Nach ein paar Jahren des Anbaus testeten die Forscher die Böden in Schichten von jeweils 4 cm Dicke bis hinunter zur Tiefe von 20 cm. Zu jedermanns Überraschung waren die Nährstoffe in den bearbeiteten Böden langsamer nach unten gewandert als in den nicht bearbeiteten Böden, wo nichts vermischt und untergepflügt worden war. Die Forscher schlossen daraus, dass in unbearbeiteten Feldern sich eine viel größere Zahl an Bodenmikroben entwickeln konnte. Jene Mikroben bildeten kleine Netzwerke von Straßen und Wegen durch den Boden, sodass sie Nährstoffe schneller und effektiver transportieren konnten, als ein Pflug dies kann. „Wenn man solche Poren durch Nichtbearbeitung öffnet“, erklärt Ward, „bewegen sich diese Stoffe rascher wegen der Aktivität der Würmer“. Mit anderen Worten: Was in der einen Umgebung übertrieben ist, muss es nicht in einer anderen sein. „Paul hat vielleicht genug Boden entwickelt, der diese übertriebenen Maßnahmen verkraften kann“, sagt Ward. „Er kann das jetzt tun, weil er immer noch organisches Material aufbaut. Aber kann nicht auf diese Weise immer so weiter machen, sonst wird der Boden irgendwann überlaufen“.
Angesichts von Kaisers besonderen Umständen ist Ward nicht besorgt wegen dessen hohen Menge an Nitrat (sogar, wenn sie bei 40–55 ppm liegen). Aber Kaisers Phosphatmengen beunruhigen ihn schon und fast jeden anderen, mit dem ich sprach. Das ist kein Wunder. Mitte Januar berichteten 18 Forscher im Magazin „Science“, dass die Verschmutzung durch Phosphat und Nitrat eine der vier Veränderungen darstellen, die durch menschliches Zutun über Jahrhunderte angerichtet worden ist und die jetzt dabei ist, die Belastungsgrenze unseres Planeten zu überschreiten. Das sollte wirklich jeden beunruhigen. Überanwendung von Phosphordünger — ein Fehler vieler Farmer — trägt noch zu einem anderen sich anbahnenden Problem bei: die Erschöpfung der weltweiten Phosphorreserven, die im Bergbau gewonnen werden.
Quelle: netzfrauen.org


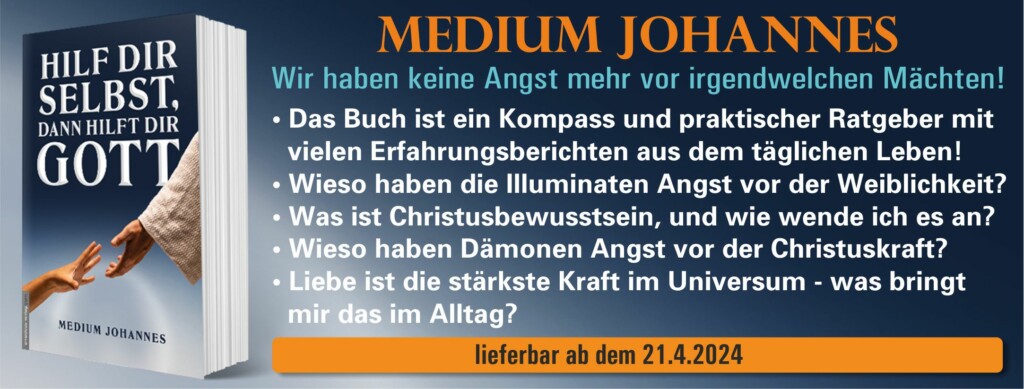




























Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.