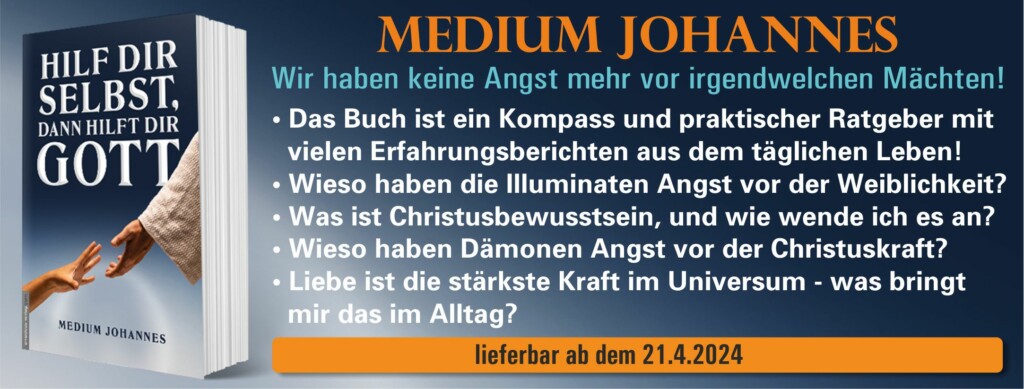Der Markt ist kein Nonnenkloster – aber auch keine Teufelsmesse
Fragwürdige Wirtschaftsethik – Wie Manager und Banker ticken.
„Gierig, risikofreudig und eigennützig“: Das sind einige der gängigen Klischees über Manager, besonders im Finanzsektor. Über die Finanzkrise 2008 sind in den letzten Jahren viele Bücher geschrieben und Filme über gierige Banker gedreht worden, die (fast) allesamt das gängige Klischee zu bestätigen scheinen.
Umweltsünden, Schmiergeldzahlungen, Stellenabbau, horrende Managergehälter oder eben die aktuelle Finanzkrise: Wenn in der Wirtschaft etwas schief läuft, gilt die rücksichtslose Gier der Manager – und damit die Profitsucht der internationalen Konzerne – als Quell´ allen Übels.
Der Gesellschaft entfremdet
Die Bankenskandale setzten letztlich auch ein Zeichen für eine völlige Entfremdung zwischen Finanzsektor und Gesellschaft. Das kommt nicht unvorbereitet: Es gibt nämlich keinen wirklichen Austausch zwischen den Finanzinstituten und der Gesellschaft. Genau besehen, verläuft die Kommunikation einseitig nach außen. Das erklärt auch, daß bei Kritik oder Vorwürfen die Banken stets „ein bißchen beleidigt“ wirken. Auch erklärlich; denn die Geldhäuser wissen in aller Regel nicht, was die Gesellschaft will bzw. von ihnen will. Banker sind nämlich grundsätzlich der Meinung, sie täten ein gutes Werk. Die Realität sieht anders aus, wie ich an den zwei Beispielen (weiter unten) erklären möchte.Zur Entfremdung der  Gesellschaft einerseits und den Banken andererseits haben auch die Medien dabei mitgeholfen, in Zeiten von Finanz- und Euro-Krise eine Sprache zu erfinden, die einer Geheimsprache gleicht, die nur noch Insider (sic!) verstehen. Meist unübersetzt haben seit Jahren vermehrt Begriffe wie Derivatehandel, Aktienfonds, Schuldendeflation, Null-Wachstum u. ä. sprachliche Hochkonjunktur. Das macht verdächtig; denn es soll wohl von der Riesenkatastrophe auf dem Finanzmarkt, der Sorge um unsere eigene wackelnde Währung oder anderen Problemen ablenken.
Gesellschaft einerseits und den Banken andererseits haben auch die Medien dabei mitgeholfen, in Zeiten von Finanz- und Euro-Krise eine Sprache zu erfinden, die einer Geheimsprache gleicht, die nur noch Insider (sic!) verstehen. Meist unübersetzt haben seit Jahren vermehrt Begriffe wie Derivatehandel, Aktienfonds, Schuldendeflation, Null-Wachstum u. ä. sprachliche Hochkonjunktur. Das macht verdächtig; denn es soll wohl von der Riesenkatastrophe auf dem Finanzmarkt, der Sorge um unsere eigene wackelnde Währung oder anderen Problemen ablenken.
In der Diskussion sollte man jedoch fairerweise zugestehen, daß man nicht alles auf die vermeintliche Gier der Banker und Vorstände oder auf mafiöse Banken- bzw. ‑Managerstrukturen schieben kann. Der Grund für solche Krisen sind schlicht auch Fehlentscheidungen, schlichte, aber schlimme Managementfehler. Wobei man durchaus den Eindruck stehen lassen darf, etliche Manager seien zu doof für ihr eigenes System (z.B. Middelhoff – als ein Beispiel von vielen).
Selbst Marktwirtschaftler unterliegen z. T. einem Irrtum:
Viele denken, wir würden in einer freien Marktwirtschaft leben. Aber so ist das nicht. Marktwirtschaft würde „freier Wettbewerb“ bedeuten. Und den haben wir hier nicht. Es gibt gewaltiges Lobbytum, einflußreiche Verbände und Großkonzerne, die sozusagen mitregieren, in enger Abstimmung mit dem Staat.
Wenn man einmal verstanden hat, daß in der Praxis der Kapitalismus sowieso nichts mit freien Märkten zu tun hat, dann ist es auch leichter zu verstehen, daß man auf gar keinen Fall die Finanzmärkte deregulieren sollte. Sondern ganz im Gegenteil: Die Banken brauchen extrem strenge Regeln. Und wenn man das nicht macht, dann gibt es die Fehlentwicklungen (siehe übernächsten Absatz), wie man ja an drei Krisen auch sehen kann.
„Kampf gegen den Kapitalismus“
Gegner unserer Wirtschaftsordnung fühlen sich durch solche Fehlentwicklungen in ihrem „Kampf gegen den Kapitalismus“ allzu gerne bestätigt. Aber es hilft nichts, das System, das unserer Wirtschaftsordnung zugrunde liegt, ist der Kapitalismus (mit sozialer Komponente = Soziale Marktwirtschaft). Und der verzeichnet zwar durch all die Krisen der Jahrhunderte Fehlentwicklungen und „Nebenwirkungen“, die häßliche Narben hinterlassen, aber er ist nicht kleinzukriegen. Es gibt bis heute keine andere Wirtschaftsordnung, die erfolgreicher war und ist als der Kapitalismus und erst recht als die Soziale Marktwirtschaft. Trotzdem können die meisten Marktteilnehmer damit bis heute nicht richtig umgehen. Verstehe, wer will!
Drei schwere Finanzkrisen
Zugegeben, die Zeiten sind schwieriger geworden, sehr viel schwieriger. Etwa seit dem Jahre 2000 befindet sich der Kapitalismus in einer Art neuen Phase: Was wir seit 2000 erlebt haben, sind drei schwere Finanzkrisen. Erst die „Dotcom-Krise“, also die Internetblase, die geplatzt ist, dann gab es die „Subprime-Krise“, also die „Hypothekenkrise“, die aus den USA über uns hereingebrochen ist, und jetzt gibt es die „Euro-Krise“.
In nur zehn Jahren drei schwere Finanzkrisen – das ist in der Geschichte des Kapitalismus völlig neu. Diese drei Krisen bilden, allgemein ausgedrückt, eine Art der Superkrise, die noch nicht bewältigt ist.
Krise des politischen Managements – eine nicht ganz unwichtige Randbemerkung:
Neben dem vorhin Geschriebenen wird vielfach übersehen, daß es noch eine die vierte Krise – eine fiskalische und eine politische gibt, letztlich eine Krise des politischen Managements. Die Euro-Krise z.B. läuft schon ein paar Jahre, in denen viele Fehler gemacht wurden, die die Gesamtproblematik verschärfen (z. B. „Null-Zins-Politik“, „No-bail-out“-Verrat etc.)
Die Krise hat natürlich auch Deutschland erreicht, und die Sparer sind dementsprechend total empört: Es gibt praktisch keine Zinsen mehr auf die Konten, so daß sich die Sparer enteignet fühlen. Und das ist auch ein Krisenzeichen; denn Zinsen müssen ja aus dem erwirtschaftet werden, was die Wirtschaft jedes Jahr produziert. Wenn sich aber praktisch ganz Europa in der Rezession befindet, kann es keine Zinsen geben.
Es hat eine Weile gebraucht – wir sind ja sooo geduldig – bis die Deutschen gemerkt haben, daß es auch sie (be-)trifft. Denn bisher wurde uns vorgemacht – und wir haben´s gerne geglaubt – bei uns sei es doch „irgendwie besser als bei den anderen“. Irrtum! Das Wohlgefühl der Deutschen, überall sei Krise, nur bei uns nicht, war eine reine Selbsttäuschung.
Banken brauchen extrem strenge Regeln
Beim Handel mit Währungen z. B. handelt es sich um ein Volumen von 4,7 Billionen Dollar pro Tag. Dieser Mega-Markt ist aber kaum reguliert. Und das, obwohl die festgelegten Kurse Auswirkungen auf eine Vielzahl anderer Vertragsbeziehungen hätten. Das hat letztlich (oder besonders) auch eine soziale Relevanz, weil dadurch eine Fehlallokation von Kapital stattfindet, und die zeitigt dann auch soziale Kosten.
Wohl die meisten Betrügereien im Bankenbereich sind aber nicht auf Geldgier zurückzuführen, sondern auf das Streben nach Anerkennung durch den Arbeitgeber und auf die Angst um den Verlust von Einkommen bzw. Arbeitsplatz. Man kann das auch pathetisch ausdrücken: Man will die Liebe dieser Institution gewinnen und vergißt darüber Moral und Regeln.
 Zwei Beispiele (aus viele anderen) mögen dies verdeutlichen:
Zwei Beispiele (aus viele anderen) mögen dies verdeutlichen:
1.) Kartellabsprachen bei Kfz-Herstellern
Die Dieselaffäre ist kein Versagen einzelner Unternehmen, sondern das Ergebnis einer jahrelangen Kungelei deutscher Autobahn – so beschreibt es der „Spiegel“. Nach Informationen des Magazins haben sich VW, Audi, Porsche, BMW und Daimler seit den 90er-Jahren abgesprochen bei mehr als tausend Treffen verschiedener Arbeitskreise und damit brisanterweise auch die Basis für den Dieselskandal gelegt, weil sie sich unter anderem über die Abgasnachbehandlung bei Dieseltanks verständigt haben.
Die betroffenen Unternehmen behaupten natürlich mit frommem Augenaufschlag, das sei ein „völlig normales und legales Vorgehen“ gewesen: „Es gab sowohl auf europäischer Ebene im Dachverband Automobilindustrie in Brüssel beim ACEA als auch natürlich beim VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie) eine Unzahl von Arbeitskreisen, die sich über alle möglichen Fragen informieren oder beziehungsweise abstimmen.
Und das sei ein ganz offizielles und ein ganz legales Vorgehen bisher. Das betrifft nicht nur die Autoindustrie. Das gibt’s im Maschinenbau, das gibt’s in der Chemie, das gibt’s in allen großen Industriezweigen. Insofern überrascht mich jetzt diese Meldung.“ Dies sagte z. B. Helmut Becker, ehemaliger Chefvolkswirt bei BMW dem DLF.
Ein Kartell – und keine Schuldigen?
Aber das hat schon ein G´schmäckle, u. zw. durchaus zu Recht. In den 1980er‑, 90er-Jahren wurden beispielsweise Preisanhebungen in der Automobilindustrie im Frühjahr regelmäßig in einem bestimmten Turnus beschlossen (und eingeführt), bei denen der Erste, der die Preise angehoben hat, sich abwechselte. Das stank zwar gewaltig nach Absprache, aber das Kartellamt hatte das über 20 Jahre lang hingenommen und keinen Anlaß gesehen einzugreifen.
Und wenn sich fünf Unternehmen über Entwicklungsschritte absprechen und da möglicherweise auch Optionen wählen, die umweltschädlicher sind und die im Endeffekt auch Menschenleben kosten, und diese Informationen nicht mit anderen Autokonzernen aus anderen Ländern beispielsweise teilen, dann nennt man dies nicht nur „Absprache“, sondern dann ist das ein Kartell und ein krasser Wettbewerbsverstoß.
Ein solcher massiver Kartellverstoß müßte eigentlich personelle und harte materielle Konsequenzen haben, und die Manager – nicht die Belegschaft – müßte zur Verantwortung gezogen werden; denn sie sind die wahren Schuldigen. Da müßte die Strafe auf dem Fuße folgen, und das würde in die Milliarden gehen. Aber es passiert (noch?) nichts. Da kann man als betrogener Bürger nur noch spotten: „VW läßt grüßen“. Nach deren Skandal (2015) ist auch nichts passiert. Und auf ein schuldbewußtes Bekenntnis auch nur eines Managers werden wir wohl lange warten müssen.
2.) Verdacht auf Insiderhandel – Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Deutsche-Börse-Chef
2005 scheiterte der Versuch, die Deutsche Börse AG, eines der bedeutendsten DAX-Unternehmen, mit der Londoner Börse zu fusionieren. Nun hatten beide Unternehmen einen neuen Anlauf für einen Zusammenschluß unternommen. Wäre die Fusion gelingen, wäre der mit Abstand größte europäische Börsenbetreiber entstanden.
„Der Zusammenschluss zwischen Deutsche Börse und London Stock Exchange hätte den Wettbewerb erheblich eingeschränkt, denn er hätte in einem wichtigen Bereich, dem Clearing festverzinslicher Finanzinstrumente, ein De-facto-Monopol geschaffen“, erklärte EU-Kommissarin Margrethe Vestager.
So geht es halt, wenn jemand aufpaßt, mag der gemeine Mensch denken und die Sache damit für erledigt halten. In diesem Falle aber nicht:
Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter. Dabei geht es um den Verdacht des Insiderhandels beim Kauf eines Aktienpakets. Die Deutsche Börse weist den Vorwurf zurück.
Ein Blick auf den Aktienkurs zeigte: Von 50 Euro zu seiner Ernennung vor drei Jahren bis hin zu gut 90 Euro stieg der Kurs, den Kengeter als dynamischer Investmentbanker dem Quasi-Monopolisten Börse AG beschert hatte.
Viele Fragen offen
 Und auch hier das übliche Zeremoniell: „Die Vorwürfe sind haltlos.“ So deutlich nahm der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Börse AG, Joachim Faber, seinen Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter in Schutz vor dem Vorwurf des Insiderhandels. Die Nachrichtenmaschinerie kam in Gang, weil die Staatsanwaltschaft Frankfurt das Büro und die private Wohnung Kengeters durchsucht hatte. Daraufhin gab die Börse eine Pflichtmitteilung an den Kapitalmarkt heraus. Die Staatsanwaltschaft habe ermittelt, steht darin, und auch: Unternehmen und Vorstandschef kooperierten in vollem Umfang mit der Staatsanwaltschaft.
Und auch hier das übliche Zeremoniell: „Die Vorwürfe sind haltlos.“ So deutlich nahm der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Börse AG, Joachim Faber, seinen Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter in Schutz vor dem Vorwurf des Insiderhandels. Die Nachrichtenmaschinerie kam in Gang, weil die Staatsanwaltschaft Frankfurt das Büro und die private Wohnung Kengeters durchsucht hatte. Daraufhin gab die Börse eine Pflichtmitteilung an den Kapitalmarkt heraus. Die Staatsanwaltschaft habe ermittelt, steht darin, und auch: Unternehmen und Vorstandschef kooperierten in vollem Umfang mit der Staatsanwaltschaft.
Es sei die Aufgabe Kengeters als Börsenchef, den Wert des Unternehmens zu steigern.
So weit alles klar? Mitnichten! Denn auch Kengeter war und ist Aktionär der Deutschen Börse AG. Das war sogar Folge seines Arbeitsvertrages, weil er auch in Aktien bezahlt wurde, um motiviert zu sein.
Um nicht mißverstanden zu werden: Kengeter hat solange als unschuldig zu gelten, bis er (evtl.) verurteilt wird. Aber – vereinfacht ausgedrückt: Kengeter war nicht irgendein Manager, sondern der Chef, der verantwortliche Lenker des Unternehmens. Und als solcher ist man selbstverständlich mit alle wichtigen Vorgängen und Vorhaben vertraut. Und dazu gehörten ganz gewiß die Pläne zu einer Fusion mit London.
Staatsanwaltschaft ermittelt
Wer wußte wann was? Das ist entscheidend für den Verdacht des Insiderhandels. Kengeter hatte im Dezember 2015 für 4,5 Millionen Euro Aktien der Deutschen Börse gekauft. Erst zwei Monate später, im Februar 2016, machte die Börse ihre Fusionspläne mit der Londoner Börse öffentlich. Aufsichtsratschef Faber ergänzte noch, erst in der zweiten Januarhälfte 2016 hätten sich die Chefs von Deutscher und Londoner Börse auf Fusionsverhandlungen verständigt. Auch das also nach Kengeters Aktienkäufen.
Die Staatsanwaltschaft hat aber andere Informationen. Und deshalb ermittelt sie wegen des Verdachts des Insiderhandels. Ihre Sprecherin Nadja Niesen:
„Der Anfangsverdacht gegen den Beschuldigten resultiert aus Gesprächen, die im Zeitraum Sommer bis Anfang Dezember 2015 durch die Leitungsebenen der Deutschen Börsen AG und der London Stock Exchange geführt wurden und die eine mögliche Fusion der beiden Unternehmen sowie auch die Frage des möglichen Sitzes der neuen Börse zum Inhalt hatten. In dem Zusammenhang wird dem Beschuldigten vorgeworfen, bereits Mitte Dezember 2015 in Kenntnis dieser bis dato nicht veröffentlichten Vertragsgespräche, welche die Staatsanwaltschaft als Insiderinformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wertet, Aktien seines Unternehmens erworben zu haben.“
Danach liefen die Gespräche also schon monatelang, bevor Kengeter Aktien kaufte.
Die Deutsche Börse verweist auf die Vergütungsregelung mit Kengeter, wonach er bis Ende 2015 aus privaten Mitteln die Aktien kaufen mußte, um ein gleichgroßes Aktienpaket als Gehalt zu bekommen. Die Staatsanwaltschaft reagiert darauf gelassen. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen:
„Hierbei handelt es sich um eine Rechtsfrage. Und da müssen wir jetzt die weiteren Ermittlungen abklären und abwarten, wie das Ganze dann letztlich rechtlich von Seiten der Staatsanwaltschaft ausgewertet wird.“
Zu bewerten sein wird dabei auch, daß der Aufsichtsrat die in Rede stehende Vergütungsregelung für Kengeter am 23. September 2015 beschloß – zu einer Zeit also, als nach Informationen der Staatsanwaltschaft das Börsenmanagement schon drei Monate mit der Londoner Börse die geplante Fusion auslotete.
Kengeter legt sein Amt nieder.
Nun kommt der überraschende Schritt – wie auch immer er zu bewerten ist: Kengeter werde sich Ende des Jahres von seinem Posten zurückziehen, teilte das Unternehmen vor wenigen Tagen in Frankfurt a.M. nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung mit. Man bedauere den Schritt. Kengeters Vertrag wäre ursprünglich Ende März 2018 abgelaufen.
Auf spekulative Fragen werde er nicht eingehen und er gebe keine weiteren Auskünfte aufgrund der laufenden Ermittlungen: Bei der persönlichen Erklärung des Börsenchefs Carsten Kengeter blieben viele Fragen unbeantwortet –zum Vorwurf des Insiderhandels.
Und die Fragen häuften sich. Warum hat Kengeter Ende 2015 Aktien der Deutschen Börse in Millionenhöhe gekauft, kurz bevor der Fusionsplan mit der Londoner Börse aufkam? Warum hat er sich dem Vorwurf des Insiderhandels ausgesetzt, den ihm nun die Staatsanwaltschaft vorhält? Warum hatte nur er das Angebot des Aufsichtsrates, die eigenen Millionenkäufe durch eine Zulage des Arbeitgebers in gleicher Höhe zu verdoppeln? Warum nicht der ganze Vorstand? usw.
 Es bleibt, wie bei dem Beispiel der Autoindustrie (s.o.), zu überprüfen, ob die sogenannte ad-hoc-Mitteilung – das ist die Mitteilung an die Aktionäre, und zwar transparent an alle Aktionäre – nicht nur an einige Aktionäre rausgegangen sind, und zwar in einer bestimmten Art und Weise und sehr zeitnah. Ob dies hier korrekt durchgeführt wurde oder nicht, ist in der Tat im Augenblick noch offen. Insbesondere ist zu prüfen, ob ein strafbewehrter Tatbestand gegeben ist.
Es bleibt, wie bei dem Beispiel der Autoindustrie (s.o.), zu überprüfen, ob die sogenannte ad-hoc-Mitteilung – das ist die Mitteilung an die Aktionäre, und zwar transparent an alle Aktionäre – nicht nur an einige Aktionäre rausgegangen sind, und zwar in einer bestimmten Art und Weise und sehr zeitnah. Ob dies hier korrekt durchgeführt wurde oder nicht, ist in der Tat im Augenblick noch offen. Insbesondere ist zu prüfen, ob ein strafbewehrter Tatbestand gegeben ist.
Gewinne maximieren
Da haben wir also zwei schwere (und schwierige) Fälle, die durchaus die Frage nach der Manager-Moral erlauben. Für viele scheint nach wie vor Milton Friedmans Diktum zu gelten: „Die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen besteht darin, Gewinne zu maximieren. Danach sind ethische Probleme gesellschaftlicher Natur, das heißt, außerhalb des Unternehmens zu lösen.“
Vieles von dem, was thematisiert wird, zum Beispiel Grundsätze wie „Versprechen sind zu halten“ oder „Wie wichtig sind einem Unternehmen die Corporate Governance-Regeln?“, erscheinen gerade Managern trotz aller Lippenbekenntnisse trivial oder im unternehmerischen Alltag nicht umsetzbar. In der Tat, die Wirtschaftspraxis scheint den Managern immer wieder unlösbare Konflikte zwischen Gewinn und Moral zu bereiten. Viele Manager glauben, daß ihr Unternehmen, wenn sie der Moral den Vorzug geben, Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen müßte.
Manager sollten aber vermeintliche Konflikte zwischen Gewinn und Moral im Vorfeld erkennen und entschärfen können – kurz: Sie müssen es schaffen, Gewinn und Moral füreinander fruchtbar zu machen. Beim moralischen Engagement von Unternehmen geht es nicht um Zusatzaktivitäten neben dem Kerngeschäft, also um Luxus“, sondern erfolgreiche Manager setzen Moral als Produktionsfaktor ein. Sie gehen Bindungen ein, die bei ihren Kapitalgebern, Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten produktive Gegenreaktionen auslösen.
Schöner Schein, raue Wirklichkeit. Der Markt ist kein Nonnenkloster, aber auch keine Teufelsmesse.